Germanistische Sprachwissenschaft
Öffentlichkeitsaktivitäten
Wörter des Jahres
- Hartz IV
- Parallelgesellschaften
- Pisa-gebeutelte Nation
- gefühlte Armut
- Ekelfernsehen
- Praxisgebühr
- Ein-Euro-Job
- aufgestellt
- Rehakles
Hartz IV
- 2004, Platz 1
Das von der Regierung Schröder beschlossene Reformprogramm der Agenda 2010 beinhaltete unter anderem die Forderung nach einer Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einem neuen Arbeitslosengeld II. Diese Maßnahme, die Einsparungen in Milliardenhöhe bezweckte, wurde vom deutschen Bundestag für den 1. Januar 2005 beschlossen – als vierter Teil der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, nach ihrem Erfinder Peter Hartz im Allgemeinen kurz Hartz-Gesetze genannt. Hartz I ermöglichte die Einführung von Personal-Service-Agenturen, die Arbeitslose gegen Honorar einstellen und als Leiharbeiter an Firmen vermitteln; Hartz II, seit April 2003 in Kraft, brachte Neuerungen wie Ich-AG und Job-Floater (ein Programm, das Arbeitgebern günstige Kredite ermöglicht, wenn sie einen neuen Arbeitsplatz schaffen); Hartz III machte seit Januar 2004 aus der Bundesanstalt für Arbeit die Bundesagentur für Arbeit.

Keine der Agenda-2010-Reformen erregte bislang allerdings mehr Leidenschaft als Hartz IV. Unter den vermeintlich Hartz-IV-Geschädigten brach eine wahre Hartz-Hysterie aus. In den neuen Bundesländern gingen zeitweise mehrere tausend Menschen auf die Straße – in historisch fragwürdiger Anknüpfung an die Montagsdemonstrationen von 1989 regelmäßig montags. „Hartz IV ist Armut per Gesetz“, plakatierte die PDS im sächsischen Landtagswahlkampf und gewann mit populistischen Aussagen wie dieser 23,6 Prozent der Stimmen. Auch die rechtsextremen Parteien NPD und DVU profitierten als Trittbrettfahrer und schafften den Einzug in die Landtage von Sachsen bzw. Brandenburg.
Das Arbeitslosengeld II, das, selbst noch nicht eingeführt, bereits zu einem neuen Kurzwort führte (ALG II, ALG 2, Alg II, Alg-2, Alg Zwo o. ä.), erhitzte die Gemüter gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen deshalb, weil es geringer ausfällt als Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammen, zum anderen deshalb, weil der zuständige Bundesminister Wolfgang Clement die Absicht kundtat, das Alg2 erstmals im Februar 2005, die alte Arbeitslosen- und Sozialhilfe aber im Dezember 2004 letztmals an die Berechtigten zu zahlen. Die einmonatige Auszahlungslücke, in der auch und gerade Kritiker aus den eigenen Reihen eine soziale Ungerechtigkeit sahen, beherrschte mehrere Wochen lang die Schlagzeilen und fachte die „Hartz-IV-Wut“ (Spiegel, 27. 8. 2004, Märkische Allgemeine, 15. 9. 2004 u. ö.) weiter an. Es half der Bundesregierung wenig, dass die vermeintliche Lücke nur auf dem Papier bestand, da die bisherige Arbeitslosen- und Sozialhilfe am Monatsende für den Folgemonat ausgezahlt wurde, das neue Arbeitslosengeld II hingegen am Monatsanfang gezahlt wird. Für die Arbeitslosenhilfeempfänger sollte sich mithin „so gut wie nichts“ ändern: „Sie bekommen ihr Geld lediglich ein paar Tage später, am Monatsanfang Februar statt am Monatsende Januar.“ (Welt, 2. 8. 2004.)
Alles in allem, befand die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (29. 8. 2004) spöttisch, war „die Sache mit ‚Hartz IV‘ [...] irgendwie suboptimal kommuniziert worden“. Zwar lasse sich das H-Wort selbst „nicht mehr so leicht aus der Welt schaffen“, aber man könne ja immerhin darangehen, „die Kernelemente der Reform konsequent neudeutsch aufzusexen und dem angekratzten Label ‚Hartz‘ durch Offensivmarketing neuen Glanz zu verleihen“. Ein Vorschlag: „Statt der ‚Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe‘ kommt jetzt das ‚Working-Class-People-Economy-Paket‘ zum ‚All-Inclusive-Tarif‘“ (ebd.). ⋄ Jochen A. Bär
Parallelgesellschaften
- 2004, Platz 2
Ausdrücke, die in einem bestimmten Jahr unter die „Wörter des Jahres“ gewählt werden, müssen nicht neu aufgekommen sein. Es genügt bereits, wenn sie einen neuen Sinngehalt angenommen haben oder emotional anders besetzt wurden, so wie es 2004 bei Parallelgesellschaft der Fall war. Das Wort selbst wurde bereits in früheren Jahren gebraucht. So schrieb der Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heitmeyer in der Zeit (23. 8. 1996), es bestehe „die Gefahr, daß religiös-politische Gruppen eine schwer durchschaubare ‚Parallelgesellschaft‘ am Rande der Mehrheitsgesellschaft aufbauen könnten.“ In der Berliner Zeitung vom 1. 11. 2001 war mit positivem Unterton zu lesen, dass die schwedische Minderheit in Finnland „eine regelrechte Parallelgesellschaft mit schwedischsprachigen Kindergärten, Schulen, Bibliotheken, Theatern, [...] selbst einer eigenen Wehrpflichtigengruppe“ errichtet habe und „diese Parallelität [...] auch allen anderen europäischen Minderheiten empfehlen könne“.
Im Jahr 2004 hingegen erschien Parallelgesellschaft immer öfter negativ besetzt. Insbesondere die muslimische oder islamische Parallelgesellschaft wurde problematisiert. In einem Beitrag zum Kopftuch-Streit – der Auseinandersetzung darüber, ob muslimischen Lehrerinnen im Unterricht das Tragen eines Kopftuchs erlaubt sein soll – schrieb beispielsweise der Göttinger Sozialwissenschaftler Niels-Arne Münch: „Das Öffnen unserer Schulen für das Kopftuch fördert nicht die Integration der Muslime, sondern das Ausbreiten eben jener Parallelgesellschaft, deren wesentliche Merkmale ein vormodernes, anti-emanzipatorisches Normensystem und Abgrenzung nach außen sind. [...] Wenn wir eine solche Parallelgesellschaft nicht wollen, sollten wir Schluss machen mit falscher Toleranz, die in Wahrheit nur Abgrenzungswünsche passiv hinnimmt.“ (Freitag, 13. 2. 2004.)
Vor allem nach der Ermordung des islamkritischen Regisseurs Theo van Gogh durch einen radikalen Islamisten in Amsterdam am 2. November 2004 und den nachfolgenden Anschlägen auf niederländische Moscheen kam in Deutschland die Diskussion um Parallelgesellschaften in Gang. „Die Bilder der Gewalt zwischen muslimischen Einwanderern und Einheimischen in den Niederlanden haben viele Menschen aufgeschreckt“, schrieb Basil Wegener (dpa, 20. 11. 2004) in einem oft nachgedruckten Artikel: „Ins Zentrum der Debatte rückt [...] die Warnung vor einer ‚Parallelgesellschaft‘. Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) kritisierte, dass islamistische Hassprediger ‚mit deutschem Pass hier in ihrer Parallelgesellschaft leben‘. Man müsse alles daran setzen, um das Entstehen neuer und die Verfestigung vorhandener Parallelgesellschaften zu verhindern, sagt [Bundesinnenminister] Schily“ (ebd.).
Nicht lange auf sich warten ließ nun der sprachkritische Zugang zum Thema. „Parallelgesellschaft ist das neue Schimpfwort“, so Arno Widmann in der Berliner Zeitung (23. 11. 2004): „Wir dulden sie nicht. Wer bei uns lebt, hat sich zu integrieren. [...] Man hört das heute fast jeden Tag auf fast allen Sendern. Es ist darum nicht richtig. Parallelgesellschaften gibt es überall. Jede Gesellschaft setzt sich aus Parallelgesellschaften zusammen. Der Versuch, die Entstehung von Parallelgesellschaften in der Gesellschaft zu verhindern, charakterisiert den autoritären Staat. Sollte es einer Gesellschaft gelingen, alle Ansätze von Parallelgesellschaften in ihr zu unterbinden, so wäre sie totalitär“ (ebd.). Der Berliner Professor Hajo Funke wies darauf hin, dass es nicht nur eine islamistische Parallelgesellschaft gebe, sondern auch „die antidemokratischen Parallelgesellschaften der Neonazis“ (Neues Deutschland, 2. 12. 2004).
Parallelgesellschaften allenthalben. „775.000 Millionäre: Sie sind die wahre Parallelgesellschaft“, titelte der sozialistische Linksruck (8. 12. 2004). Neben solch politischer Sprachkritik gab es auch eine ironische: „Schon lange nicht mehr hat ein Wort mich so sehnsüchtig werden lassen wie Parallelgesellschaft. Man sollte glatt eine begründen“, hieß es am 23. 11. 2004 in einer Internet-Chronik (http://arrog.antville.org/20041123). Andere waren da schon einen Schritt weiter: „Auch ich lebe in einer Parallelgesellschaft“, gestand Barbara Bollwahn in der taz (8. 12. 2004). „Ich arbeite bei einer westdeutschen Tageszeitung. Ich spreche Hochdeutsch. [...] Ich fahre nur relativ selten in meine sächsische Heimat. [...] Doch nach der Arbeit, da [...] spreche ich breites Sächsisch. [...] Da gucke ich meinen Heimatsender MDR, bis die Bildröhre glüht. Da lebe ich in einer Parallelgesellschaft.“ ⋄ Jochen A. Bär
aufgestellt
- 2004, Platz 8
Mit der Aufnahme von aufgestellt unter die Wörter des Jahres 2004 hat die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden keine allzu überzeugende Wahl getroffen. Denn es handelt sich keineswegs um ein typisches „Jahreswort“ für 2004. Vielmehr hat die Wiesbadener Jury eine sprachliche Entwicklung der zurückliegenden Jahre offenbar nicht wahrgenommen: Die vermeintlich neue Verwendung des Wortes aufstellen bzw. des Perfektpartizips aufgestellt, um die es in diesem Kontext geht, ist bereits seit den frühen 1990er Jahren gut belegt, wie in einem just im Jahr dieser Wahl erschienenen Aufsatz (Bär 2004) auch breit dokumentiert ist. Das Verbaladjektiv aufgestellt bedeutet hier – insbesondere in wirtschaftlichen und unternehmenspolitischen Zusammenhängen – so viel wie ›im Wettbewerb positioniert‹ oder ›strukturell und hinsichtlich strategischer Möglichkeiten beschaffen (im Vergleich mit der Konkurrenz)‹; ein Unternehmen kann beispielsweise gut, exzellent, optimal, breit oder überzeugend aufgestellt sein. Da es nicht nur von Interesse, ist, wie, sondern auch wo man aufgestellt ist, kommt kommt zu der qualitativen Bestimmung nicht selten auch noch eine Orts- oder Bereichsangabe: „in Zentral- und Osteuropa sehr gut aufgestellt“ (Salzburger Nachrichten, 9. 9. 2000), „gut aufgestellt auf dem Binnenmarkt Japan“ (Die Presse, 30. 9. 2000), „in Ludwigshafen gut aufgestellt“ (Mannheimer Morgen, 25. 10. 2001), „technologisch gut aufgestellt“ (ebd., 14. 11. 2001).
Die somit zwar nicht für 2004 jahrestypische, gleichwohl aber vergleichsweise neue Verwendung lehnt sich offenbar an die Bildlichkeit des Militärs oder auch (heute vermutlich näherliegend, nicht zuletzt angesichts des Selbstverständnisses international aufgestellter Unternehmen als global players) des Sports an: Man kennt seit langem die Kampf- oder Wettkampfaufstellung von Truppen oder Mannschaften, und dieser Wortgebrauch, der bis in die jüngste Zeit verbreitet ist („die Dorfältesten haben eine eigene Milizen aufgestellt und die Extremisten vertrieben“, Hannoversche Allgemeine Zeitung, 4. 1. 2010), dürfte die Übertragung auf den wirtschaftlichen Bereich begründen. Nicht minder gern bedient sich vor dem gleichen Hintergrund die Politik des Wortes: Die bayrische Landes-SPD fand sich selbst bereits im Jahr 2004, also lange vor dem großen Wahldesaster der CSU 2008, „recht ordentlich aufgestellt“ (Nürnberger Nachrichten, 12. 11. 2004). Verwendungen wie diese zeigen, dass es bei der neuen Verwendung des Wortes aufgestellt in aller Regel um eines geht: um Eigen-PR. Zwischen vor Kraft nicht laufen können und einsamem Pfeifen im Wald ist dabei das Spektrum ziemlich breit. Die Fügung gut aufgestellt ist nicht umsonst eine der häufigsten, in denen das Wort belegt ist. Aufgestellt ist im Zusammenhang mit gut in den über vier Milliarden Textwörter umfassenden digitalen Quellenkorpora des Mannheimer Instituts für Deutsche Sprache über 6400 Mal belegt und damit beispielsweise mehr als zwölfmal so oft wie die Fügung ein Schild aufstellen und fast zwanzigmal so häufig wie einen Rekord aufstellen.
Irgendwie (meistens eben gut) ist man heutzutage überall dort aufgestellt, wo es um Wettbewerb oder selbst nur schlichten Vergleich geht: „Wären die nötigen Rücklagen gebildet worden, wäre die Beamtenversorgung besser aufgestellt als der Rentenbereich“ (Braunschweiger Zeitung, 14. 1. 2010). Wenngleich kein typisches Jahreswort, so hat die Wiesbadener Jury also doch immerhin – oder sogar – ein „Jahrzehntwort« „entdeckt“. Denn das aufgestellt sein lässt sich offenbar kaum noch abstellen. Selbst der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) ist „an der südhessischen Müllfront optimal aufgestellt“ (Mannheimer Morgen, 22. 1. 2004). ⋄ Jochen A. Bär
Alternativen
Neben den oben genannten, am 10. 12. 2004 von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden bekannt gegebenen „Wörtern des Jahres“ spielten 2004 noch etliche weitere Wörter eine Rolle. Eine kleine und subjektive Auswahl sei hier – in alphabetischer Reihenfolge, ohne Gewichtung – präsentiert.
Auffanglager
- 2004 nicht auf der Jahreswörterliste der Gesellschaft für deutsche Sprache, aber trotzdem prägend für das Jahr
Im Juni 2004 einigten sich Regierung und Opposition nach jahrelangem Ringen auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf, um Einreise, Aufenthalt und Integration von Ausländern in Deutschland neu zu regeln. Das Gesetz, von Bundesinnenminister Otto Schily als „historische Wende in Deutschland“ gepriesen, zog einen Schlussstrich unter die Zuwanderungsdebatte.
Der sachlichen Einigung war eine sprachliche vorausgegangen: eine auf ein neues Schlagwort. Der Ausdruck Zuwanderung (womit früher innerstaatliche Wanderungsbewegungen bezeichnet wurden) ersetzte nämlich keineswegs zufällig das früher gebräuchliche Wort Einwanderung. Vielmehr versuchten die Parteien „mit dieser – überaus erfolgreichen – Sprachwäsche ihre Vergangenheit zu verwischen. Die Union wollte nicht länger an ihre Haltung erinnern, daß Deutschland ‚kein Einwanderungsland‘ sei; aber auch die Grünen haben sich mit ihrer gegenteiligen Forderung nicht durchsetzen können. So hat man sich [...] darauf geeinigt, den Tatbestand wenigstens sprachlich neu zu fassen.“ (FAZ, 18. 6. 2004.)
Kaum war jedoch das Zuwanderungsgesetz unter Dach und Fach, machte das Thema erneut Schlagzeilen. Aus wirtschaftlicher und sozialer Not unternahmen immer mehr Menschen das Wagnis, mit seeuntüchtigen Booten von Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Viele von ihnen verloren dabei ihr Leben. Dies, erklärte der Bundesinnenminister in einem FAZ-Beitrag (23. 7. 2004), könne und dürfe zwar „niemanden gleichgültig lassen“, doch könne man deshalb noch lange nicht allen, denen es in Afrika schlecht gehe, Asyl in Europa gewähren. Vielmehr müsse man „Afrikas Probleme in Afrika lösen“ (ebd.). Es sei falsch zu fordern, „alle Menschen, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet werden oder die es beispielsweise mit Schlauchbooten schaffen, in die Nähe der italienischen Küste zu gelangen, sollten an Land gelassen werden und die Möglichkeit erhalten, Asyl zu beantragen“ (ebd.). Schilys Gegenvorschlag: „die Prüfung der Fluchtgründe in einer von der EU probeweise in einem nordafrikanischen Staat mit dessen Billigung einzurichtenden Außenstelle“ vorzunehmen (ebd.).
Ein Sturm der Entrüstung war vorprogrammiert. Die wenigsten waren geneigt, Einrichtungen dieser Art als EU-Außenstellen zu bezeichnen. Von Auffanglagern war stattdessen vielfach die Rede, auch von EU-Flüchtlingslagern, Asylbewerberlagern oder, in der typischen Manier eines auflagenstarken Boulevardblattes, von „Asyl-Camps“ (Bild, 21. 7. 2004). Schilys Vorschlag versetzte nicht zuletzt sein eigenes politisches Lager in Aufregung. Von einem „Koalitionskrach um Flüchtlingspolitik“ berichtete die Welt (2. 8. 2004) – wohl nicht ganz zu Unrecht. Die Politik des Ministers, erklärte die Vorsitzende der Grünen, Angelika Beer, habe sich „von den Grundlagen der rot-grünen Flüchtlingspolitik entfernt“.
Dass sich „einige meiner grünen Freunde gewaltig aufplustern“ würden, hatte Schily einkalkuliert: „Einige“, hatte es bereits in seinem FAZ-Beitrag vom 23. Juli geheißen, „geifern beim Thema Asyl und Migration einfach drauflos, ohne die geringste Bereitschaft, sich auf eine sachliche Argumentation einzulassen“. Nicht wenige Kritiker brachten aber durchaus sachliche Bedenken vor, und manche waren kaum von der Hand zu weisen. Rechtsschutz für die Flüchtlinge, so beispielsweise Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung (2. 8. 2004), sei „offenbar nicht geplant“, da die Lager außerhalb der Zuständigkeit deutscher oder überhaupt europäischer Gerichte konzipiert seien. Zudem werde das im Grundgesetz garantierte Recht auf Asyl faktisch beschnitten, wenn man diejenigen, die darauf Anspruch haben könnten, schon vor der Grenze abfange. Ein Antrag auf Asyl lässt sich rechtlich nämlich „nur dann realisieren, wenn der Flüchtling den Fuß auf deutschen Boden“ setzen kann (ebd.). ⋄ Jochen A. Bär
europafähig
- 2004 nicht auf der Jahreswörterliste der Gesellschaft für deutsche Sprache, aber trotzdem prägend für das Jahr
Im Mai 2004 nahm die Europäische Union zehn Staaten auf: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und den Südteil Zyperns. Noch vor dem offiziellen Beitritt durften die Neumitglieder mit über die vom europäischen Verfassungskonvent unter Vorsitz des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing erarbeitete EU-Verfassung abstimmen. Dabei zeigte Polen (gemeinsam mit Spanien) eine Europafähigkeit der besonderen Art: Warschau und Madrid verhinderten die geplante Unterzeichnung der europäische Verfassung, weil diese das Prinzip der doppelten Mehrheit vorsah. Bei politischen Entscheidungen sollte nicht mehr allein nach Staaten abgestimmt werden, sondern auch nach der Anzahl der von einem Staat repräsentierten Bürgerinnen und Bürger, und Spanien und Polen fühlten sich daher gegenüber bevölkerungsreicheren Ländern wie Deutschland und Frankreich im Nachteil. (Erst im zweiten Anlauf konnte die EU-Verfassung allen Mitgliedern schmackhaft gemacht und, im Oktober 2004, in Rom unterzeichnet werden.)
Für europafähig in einem anderen Sinn befand der deutsche Außenminister Joschka Fischer im Oktober 2004 ein Land, das (noch) kein EU-Mitglied ist, es aber gerne werden möchte: die Türkei. Fischers Äußerung entsprach der Linie der Bundesregierung, Beitrittsverhandlungen mit Ankara zu befürworten. Ob solche Verhandlungen, die letztlich nur auf eine Mitgliedschaft hinauslaufen können, tatsächlich wünschenswert seien, wurde nicht nur in Deutschland sehr kontrovers diskutiert.
„Sind Sie Europäer, Erdogan Efendi?“ (türkisch: ›Herr Erdogan‹), fragte die Bild-Zeitung (2. 8. 2004) den türkischen Premier. Seine Antwort: „Natürlich gehört die Türkei geografisch und kulturell zu Europa. Europa hat sich historisch gesehen in der Türkei gefunden. Und die Türkei wiederum hat sich in Europa gefunden – also gehören beide zusammen. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach einem Beitritt irgendwelche Anpassungsprobleme geben könnte.“ (Ebd.)
Andere konnten dies durchaus. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel beispielsweise war und ist keineswegs der Auffassung, dass die Türkei zu Europa gehöre. Obwohl sie von einer kurzzeitig erwogenen Unterschriftenaktion gegen Ankaras EU-Beitritt rasch wieder Abstand nahm, blieb sie bei ihrer Ablehnung von Beitrittsverhandlungen und forderte statt dessen, der Türkei eine privilegierte Partnerschaft mit der Europäischen Union anzubieten. Von der Regierungskoalition musste sie sich daraufhin vorhalten lassen, sie breche mit alter CDU-Tradition, da sowohl Konrad Adenauer wie Helmut Kohl stets für eine türkische EU-Mitgliedschaft gewesen seien.

Unterdessen ist in Deutschland – zu schweigen von anderen europäischen Ländern – selbst die Frage, welche Art von Anpassung der Türkei abzuverlangen sei, längst nicht ausdiskutiert. Zwar hat Ankara bereits so viel in Sachen Beachtung der Menschenrechte getan, dass deutsche Gerichte zuletzt keinen Anlass mehr sahen, den radikalen Islamisten Metin Kaplan, einen Feind des Rechtsstaates, mit den Mitteln des Rechtsstaates zu schützen und keine Einwände mehr gegen eine Auslieferung des Kalifen von Köln an die Türkei erhoben. Dies könnte aber unter Umständen noch immer zu wenig sein, denn die Vorstellungen von Integration sind bisweilen recht speziell. Wer sich integrieren will, darf demnach die Anpassung auf keinen Fall zu weit treiben. Beispielsweise plädierte im Kopftuchstreit, d. h. in der Frage, ob muslimische Lehrerinnen im Unterricht das als religiöses Symbol verstandene Kopftuch tragen dürfen, der Münsteraner Rechtswissenschaftler Janbernd Oebbecke für „eine Art staatlich konzessioniertes Kopftuchmodell“, das beispielsweise durch eine „bestimmte Farbgebung oder ein aufgedrucktes Landeswappen“ zeige, dass die Trägerin „nichts zu schaffen habe mit islamistischen Bestrebungen“ (FAZ, 18. 6. 2004).
Sofern sich Vorschläge wie diese durchsetzen, wird die streng säkulare Türkei, die Trägerinnen von Kopftüchern ebenso wie Träger von Vollbärten bislang zum Staatsdienst nicht zulässt, weil beides als Bekenntnis zum religiösen Fundamentalismus gilt – die Türkei wird sich überlegen müssen, diese Praxis zu ändern, um in Bezug auf Liberalität und Toleranz hinreichend europafähig zu erscheinen. ⋄ Jochen A. Bär
Kopfpauschale
- 2004 nicht auf der Jahreswörterliste der Gesellschaft für deutsche Sprache, aber trotzdem prägend für das Jahr
Wie das Milliarden teure deutsche Gesundheitssystem in Zukunft finanziert werden soll, darüber wurde 2004 anhand zweier unterschiedlicher Modelle diskutiert. Der Vorsitzende der von der Regierung einberufenen Expertenkommission, Bert Rürup, hatte bereits im April 2003 ein Modell vorgeschlagen, das die Zahlung einer einheitlichen Kopfpauschale von monatlich 169 Euro pro versicherter Person vorsah. Mit dieser Prämie sollten sämtliche Kosten im Gesundheitswesen gedeckt werden. Ein zusätzlicher Beitrag in Relation zum jeweiligen Einkommen war nicht vorgesehen; sozial Schwache sollten über das Steuersystem entlastet werden. Der Arbeitgeberanteil sollte auf einen bestimmten Fixbetrag beschränkt werden, um zu verhindern, dass höhere Kosten im Gesundheitswesen sich nachteilig auf den Arbeitsmarkt auswirken.
Auf dem Leipziger CDU-Parteitag 2003 hatte sich die Parteichefin Angela Merkel in einer Grundsatzrede auf das Rürup-Modell festgelegt, es damit zum Prestigeobjekt ihrer Sozial- und Gesundheitspolitik erhoben und eng mit ihrem eigenen Namen verknüpft. Die bayerische Schwesterpartei CSU forderte hingegen, Geringverdienende nicht erst nach Steuern, sondern von vornherein weniger stark zur Kasse zu bitten als Wohlhabende. Die Kopfpauschale sollte demnach nur bei etwa 100 Euro liegen; darüber hinaus sollten die Versicherten 3,5 Prozent ihres Gehalts als Beitrag zahlen, um für den sozialen Ausgleichs innerhalb des Systems zu sorgen.
Der Gesundheitsstreit lähmte die Unionsparteien monatelang und bescherte ihnen bei Umfragen deutliche Sympathieverluste. Wendungen wie Poker um die Kopfpauschale und Wirrwarr um die Kopfpauschale beherrschten die Schlagzeilen. Die Auseinandersetzung drohte zwischenzeitig zu einer regelrechten Fehde über die Kopfpauschale auszuarten, da die Kontrahenten auch vor persönlichen Angriffen nicht zurückschreckten. Zum Hauptgegner der CDU avancierte der CSU-Gesundheitsexperte Horst Seehofer, der dem als unsozial empfundenen Kopfpauschalen-Modell hartnäckigen Widerstand entgegensetzte und es als „Sympathiekiller“ bezeichnete. Zudem befürchtete Seehofer, dass es nach Einführung der von der CDU geplanten Kopfprämie zu einer Erhöhung derselben kommen werde. Die Kosten des Sozialausgleichs könnten sich binnen vier Jahren auf 45 Milliarden Euro erhöhen (Financial Times Deutschland, 5. 8. 2004). Der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung, Rauen, warf Seehofer daraufhin eine „Außenseiterposition“ und „Nestbeschmutzung“ vor. Aus der CSU verlautbarte zwischenzeitlich, die CDU sei bereit, von der Gesundheitsprämie abzurücken, was CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer, verärgert über solche „Psychotricks“ der Schwesterpartei (Spiegel, 22. 10. 2004) umgehend dementierte. Seehofer, der auf seiner Kritik an der Kopfpauschale beharrte, überwarf sich am Ende mit seiner eigenen Partei, die mehrheitlich den Schulterschluss mit der CDU suchte, und stellte seine Ämter als gesundheitspolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag zur Verfügung.
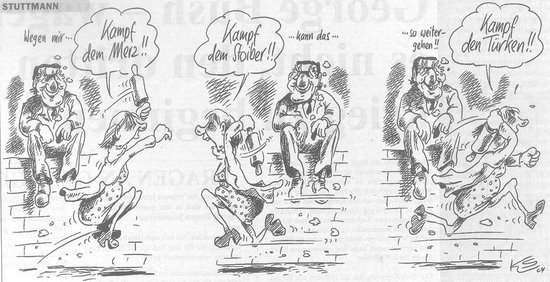
Die rot-grüne Regierungskoalition, die gegen den Vorschlag ihres eigenen Experten Rürup (aber in Übereinstimmung mit einigen Mitgliedern der in sich selbst uneinigen Rürup-Kommission) das Modell einer Bürgerversicherung bevorzugte – alle Bürger sollen einzahlen, also auch Selbstständige und Beamte, die bislang nicht gesetzlich, sondern privat versichert sind –, verschob alle diesbezüglichen Entscheidungen auf die nächste Legislaturperiode, ersparte sich so vor der Bundestagswahl 2006 eine Debatte, die sicherlich auch sie Sympathien gekostet hätte, und konnte, nachdem ihr eigenes Debakel, die Hartz-IV-Wut, erst einmal überstanden war, zunehmend entspannt der Selbstzerfleischung der Unionsparteien zusehen. ⋄ Jochen A. Bär
Mitnahmementalität
- 2004 nicht auf der Jahreswörterliste der Gesellschaft für deutsche Sprache, aber trotzdem prägend für das Jahr
Die Moralmahnung mit der signifikanten Binnenalliteration ist ein Kanzlerwort, das nicht vom Kanzler stammt: Bei Mitnahmementalität handelt es sich um eine journalistische Verkürzung dessen, was Gerhard Schröder im September 2004 in einem Interview mit der Verbraucherzeitschrift Guter Rat tatsächlich gesagt hat. Der Bundeskanzler wörtlich: „In Ost wie West gibt es eine Mentalität bis weit in die Mittelschicht hinein, dass man staatliche Leistungen mitnimmt, wo man sie kriegen kann, auch wenn es eigentlich ein ausreichendes Arbeitseinkommen in der Familie gibt“.
In den Tageszeitungen, die unmittelbar darauf über Schröders Kritik berichteten, wurde der Rüge-Satz zum Schlag-Wort: „Bundeskanzler Gerhard Schröder hat großen Teilen der deutschen Bevölkerung eine ‚Mitnahme-Mentalität‘ bei der Beanspruchung von Sozialleistungen vorgeworfen“, las man beispielsweise in der Ostthüringer Zeitung (17. 9. 2004).
Schröders Aufruf für mehr Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen der Sozialsysteme auch dann, „wenn es konkret wird und der Einzelne Auswirkungen auf die eigene Lebenssituation befürchtet“, wurde in allen Medien aufgegriffen und rief ein großes, allerdings ein dissonantes Echo hervor. „Kanzlerschelte: Sind wir ein Volk von Egoisten?“, fragte Sabine Christiansen in ihre TV- Runde (26. 9. 2004).
Die Allianzen waren politisch bunt gemischt. Vertreter der Wirtschaft wie der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Ludwig Georg Braun, aber auch die Deutsche Steuergewerkschaft gaben dem Kanzler Recht. Jeder bediene sich „zu Lasten der anderen, wo es nur geht“, erklärte der Vorsitzende des Berufsverbandes der Finanzbeamten, Dieter Ondracek. Das gelte bei staatlichen Hilfen und bei der Steuer. Der Grünen-Politiker Winfried Hermann, sonst eher kanzlerkritisch eingestellt, forderte: „Wir bräuchten – nach den Worten des ehemaligen US-Präsidenten Kennedy – Menschen, die sagen: Was kann ich für unser Land tun?“ Der ehemalige Regierungssprecher Peter Boenisch (CDU) formulierte es etwas anders und plädierte im Bayerischen Rundfunk für einen „Verantwortungsstaat“ im Gegensatz zum „Versorgungsstaat“ (21. 9. 2004).
Demgegenüber sprach der SPD-Bundestagsabgeordnete Dieter Wiefelspütz von „Volksbeschimpfung“. Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer warnte vor pauschalen Verurteilungen. Wissenschaftlichen Studien zufolge komme auf jeden Sozialhilfeempfänger ein Bürger, der zwar Sozialhilfe beantragen könnte, dies aber aus Stolz, Scham oder Unwissen unterlasse. Ein Sprecher des Deutschen Caritas-Verbandes wies darauf hin, dass dem Staat jährlich zwischen 70 und 80 Milliarden Euro allein durch Steuerhinterziehung entgingen. Seine Kritik: Der Kanzler verschweige, dass die Mitnahmementalität bis in die höchsten Etagen verbreitet sei. Der Soziologe Gerd Nollmann von der Universität Duisburg schließlich urteilte: „Wer mitnimmt, was er kriegen kann, verhält sich rational“. Es sei „der Wohlfahrtsstaat selbst, der die Ansprüche wecke und die Menschen zu Mitnehmern mache“ (Welt, 18. 9. 2004). ⋄ Jochen A. Bär
phischen
- 2004 nicht auf der Jahreswörterliste der Gesellschaft für deutsche Sprache, aber trotzdem prägend für das Jahr
Ein neues Verb wurde 2004 geschaffen – ein fachsprachliches zwar, aber eines, das für etliche Mitglieder der deutschen Sprachgemeinschaft durchaus unliebsame Relevanz besitzen dürfte. Phischen nennt man das Abfangen von geheimen Kundeninformationen beim Internet-Banking: Mit gefälschten Web-Seiten und E-Mails versuchen Betrüger, an die Zugangsdaten zu fremden Bankkonten zu gelangen, um diese anschließend leerräumen zu können. Wer auf die seriös wirkenden Nachrichten hereinfällt, die meist zur Datenaktualisierung auffordern, und die gleichfalls seriös wirkenden Internetseiten aufsucht, wird dort gebeten, seine geheimen PIN- und TAN-Codes (persönliche Identitätsnummer und Transaktionsnummer) einzugeben – was nichts anderes bedeutet, als den Betrügern einen Blankoscheck auszustellen.
Diese Art des digitalen Trickbetrugs, die seit einigen Jahren vor allem großen US-Banken zu schaffen macht und allein 2003 zu Schäden von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar führte, wird mittlerweile verstärkt auch in Deutschland angewendet. Bereits im April hatte eine Fachzeitschrift in einem Beitrag mit dem Titel „Daten-Phischer auf dem Vormarsch“ berichtet: „Wie der Anbieter Messagelabs warnt, hat die Zahl der abgefangenen Phisching-Mails in den letzten Monaten drastisch zugenommen. Gingen dem Mail-Security-Spezialisten im September 2003 gerade 279 derartige Mails ins Netz, waren es im Januar 2004 bereits rund 337000. Aufsehen erregte beispielsweise der Versuch, Kundendaten von Ebays Bezahldienst ‚Paypal‘ auszuspionieren. Wie Messagelabs mitteilt, blieb aber auch die Basler Kantonalbank in der Schweiz nicht verschont. Gauner hatten versucht, Kontoangaben zu phischen.“ (Computerwoche, 20. 4. 2004).
Das Neuwort phischen ist eine Eindeutschung des englischen phishing (das allerdings in deutschsprachigen Texten oft auch einfach erhalten bleibt; man findet Wortbildungen wie Phishing-Attacke, -Angriff, -Betrüger, -Versuch und -Mail). Die englische Kunstbildung wird üblicherweise als Kontamination (Zusammenziehung) aus password-fishing (›Angeln nach Zugangsberechtigung‹) erklärt. Dabei müsste nach klassischem Kontaminationsmuster allerdings »pishing« herauskommen, und es wäre, um die Form phishing zu erhalten, gleichsam eine doppelte Überlagerung anzunehmen: zum einen die der Wortbestandteile von p(assword) und (f)ishing, zum anderen eine von p-Schreibung und f-Lautwert, die durch die Buchstabenkombinationph erreicht wird. Einfacher scheint da die Erklärung, dass phishing nichts weiter sei als ein fishing, bei dem das f durch ph ersetzt wurde. Dergleichen ist im Internetjargon durchaus üblich: Es begegnen Formen wie phine (= fine ›fein‹) oder phat (= fat ›fett‹, jugendsprachlich ›klasse, beeindruckend, überwältigend‹), aber auch deutsche Spielschreibungen wie phalsch (= falsch) oder Phrage (= Frage).
Allerdings dürften beim Phischen selbst harte Sprachpuristen die Meinung teilen, dass die Sache schlimmer ist als das Wort. Zwar wird der digitale Datenklau von professionellen Internetfahndern in den meisten Fällen rasch entdeckt und unterbunden; manche Phischzüge enden sogar schon, bevor die Betrüger überhaupt online gehen können. Doch Experten sehen für die Zukunft große Probleme auf die Banken zukommen: „Inzwischen gibt es im Internet ganze Baukästen zum Runterladen, mit denen selbst Hackerlaien auf Beutezug gehen können“ (Spiegel, 30. 8. 2004). Bis die Geldinstitute flächendeckend höhere Sicherheitsstandards eingeführt haben, hilft gegen Phischer nur zweierlei: „nie auf Aufforderung eine TAN-Nummer eingeben – und jede E-Mail genau lesen. ‚Es ist uns ein Vergnuegen, Sie zu bedienen‘, schrieben die Netzpiraten [...] ihren potenziellen Opfern und unterzeichneten mit ‚Kundenunservice deutsche bank‘“ (ebd.). ⋄ Jochen A. Bär