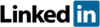Ein Auszug aus: Rieckmann, M. (2021). Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ziele, didaktische Prinzipien und Methoden. merz Zeitschrift für Medienbildung, 2021/04: MedienBildung für nachhaltige Entwicklung, S. 10-17.
Die Menschheit überschreitet mit ihrem Wirken bereits seit einigen Jahrzehnten die ökologischen Grenzen des Planeten (vgl. Steffen et al. 2015); nach wie vor ist keine Trendumkehr erkennbar. So steigen die anthropogenen Treibhausgasemissionen weltweit immer noch; weiterhin findet ein großes Artensterben statt, das die Integrität des Planeten und die Fähigkeit der Erde gefährdet, die Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen (vgl. UN Environment 2019). Auch bestehen weiterhin große soziale Herausforderungen. Insbesondere in weiten Teilen Afrikas ist es bisher nicht gelungen, die Armut wesentlich zu reduzieren (vgl. World Bank 2020), und die Corona- Pandemie hat weltweit zu einer Zunahme von Armut und Ungleichheit geführt (vgl. Mahler et al. 2021).
Zur Bewältigung dieser ökologischen und sozialen Herausforderungen bedarf es einer „Großen Transformation“ (vgl. WBGU 2011), die durch eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden soll.
Dabei lässt sich eine nachhaltige Entwicklung durch folgende konstitutive Elemente charakterisieren (vgl. Heinrichs 2007; Kopfmüller et al. 2001; Ott/ Döring 2004; Pufé 2014):
- Gerechtigkeit: Eine nachhaltige Entwicklung strebt nach intragenerationeller Gerechtigkeit (Verteilungsgerechtigkeit zwischen Nord und Süd, Reich und Arm) und intergenerationeller Gerechtigkeit (Ausgleich zwischen heutigen und künftigen Generationen).
- Ökologische Grenzen: Die ökologische Tragfähigkeit beschreibt die Grenzen unserer wirtschaftlichen Aktivitäten und unserer gesellschaftlichen Entwicklung.
- Globale Orientierung: Die Analyse von Problemen der Nicht-Nachhaltigkeit und deren Lösung verlangen nach einer globalen Orientierung.
- Partizipation: Eine nachhaltige Entwicklung ist ein gesellschaftlicher Lern-, Verständigungs- und Gestaltungsprozess, der erst durch die Beteiligung möglichst Vieler mit Ideen und Visionen gefüllt und vorangetrieben werden kann.
Konkretere Leitlinien für diese notwendige, globale Transformation zeigen die Sustainable Development Goals (SDGs) auf. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele bilden den Kern der im Jahr 2015 von der UN-Vollversammlung verabschiedeten Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung (vgl. Vereinte Nationen 2015). Wesentliche Merkmale der Agenda 2030 sind ihre Universalität und Unteilbarkeit. Alle Länder – aus dem Globalen Süden und dem Globalen Norden – müssen ihre eigenen Entwicklungsbemühungen an dem Ziel ausrichten, den Wohlstand zu fördern und gleichzeitig den Planeten zu schützen (vgl. Messner/Scholz 2015). Insofern können in Bezug auf die SDGs weltweit alle Länder als Entwicklungsländer betrachtet werden; alle müssen sie dringende Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ergreifen. Seit Ende der 1990er Jahre wird in der bildungswissenschaftlichen Diskussion sowie der Bildungspraxis verstärkt Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung genommen. In diesem Kontext ist das Konzept einer ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ (BNE) entwickelt worden (vgl. Michelsen/ Fischer 2015; Rieckmann 2016). BNE zielt darauf ab, Menschen zu befähigen, sich an den gesellschaftlichen Lern-, Verständigungs- und Gestaltungsprozessen für eine nachhaltige Entwicklung, der Umsetzung der SDGs und damit der Förderung der „Großen Transformation“ (vgl. WBGU 2011) zu beteiligen. Die Relevanz von BNE wird in den SDGs ausdrücklich als Teil des Ziels 4.7 anerkannt:
„Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.“ (Vereinte Nationen 2015, S. 19)
Gleichzeitig ist es wichtig, die zentrale Bedeutung von BNE für alle anderen 16 SDGs zu betonen. BNE ermöglicht es allen Individuen, zur Erreichung der SDGs beizutragen, indem sie mit den notwendigen Kenntnissen und Kompetenzen ausgestattet werden, die sie nicht nur brauchen, um zu verstehen, worum es bei den SDGs geht, sondern auch um sich als informierte Bürger*innen für die notwendige Transformation einzusetzen (vgl. Rieckmann 2018a; UNESCO 2017).
[…]
BNE soll alle Menschen befähigen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen zu können. Daher zielt sie auf die Entwicklung von Schlüsselkom-petenzen1, die für eine nachhaltige Entwicklung besonders relevant, aber bei den meisten Menschen bisher noch defizitär ausgeprägt sind (vgl. de Haan et al. 2008; Rieckmann 2016). Sie soll Individuen in die Lage versetzen, „wenn sie entsprechende Ziele, Zwecke oder Absichten haben“, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung handeln zu können (de Haan et al. 2008, S. 117). Es geht mithin um die „Eröffnung von Möglichkeiten“ (ebd., S. 123) und nicht darum, zu einem bestimmten vermeintlich nachhaltigkeitskonformen Verhalten zu erziehen. Die Lernenden sollen – als „Nachhaltigkeitsbürger*innen“ (Rieckmann/Schank 2016) – selbst über Fragen einer nachhaltigen Entwicklung nachdenken und ihre eigenen Antworten finden können. Dieses emanzipatorische BNE-Verständnis (vgl. Vare/Scott 2007; Wals 2011) wird damit dem Anspruch Allgemeiner Bildung Klafkis (2007) gerecht.
BNE beschränkt sich jedoch nicht auf die Entwicklung von Kompetenzen; sie zielt als transformative Bildung auch auf die „Transformation des individuellen ‚Selbst- und Weltverhältnisses‘ (Koller 2011, S. 16) im Sinne einer globalen Perspektive“ (Scheunpflug 2019, S. 66).
[…]
BNE stellt einen direkten Zusammenhang zwischen individuellen Veränderungen und gesellschaftlichem Wandel her und kann somit als transformative Bildung betrachtet werden (vgl. Koller 2018; Scheunpflug, 2019).
[…]
Für eine Transformation im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung bedarf es aber auch struktureller und institutioneller Veränderungen (vgl. WBGU 2011). Daher sollte BNE nicht nur die Ebene individuellen Verhaltens – und den dafür nötigen Wissens- und Kompetenzerwerb sowie eine entsprechende Werteorientierung – fokussieren, sondern auch die Frage nach den Strukturen, nach der „Großen Transformation“ (ebd.) aufwerfen. BNE sollte zur (politischen) Bildung von Nachhaltigkeitsbürger*innen beitragen, die – im Sinne transgressiven Lernens – befähigt sind, die bestehenden Strukturen in Frage zu stellen, über diese hinauszudenken und somit zur strukturellen und institutionellen Transformation beitragen zu können (vgl. Balsiger et al. 2017; Rieckmann 2017, 2020; Rieckmann/Schank, 2016). […]
 ENGLISH
ENGLISH