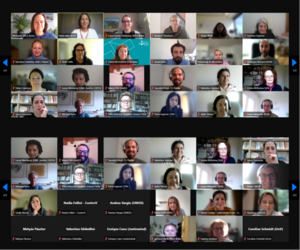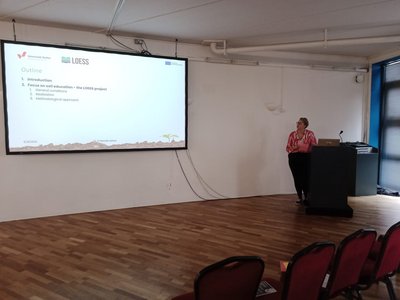Kompetenzzentrum Regionales Lernen
Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen bringt Schulen und außerschulische Akteur:innen für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zusammen.
Basierend auf dem Bildungskonzept Regionales Lernen 21+ werden thematische Bildungsnetzwerke und Bildungslandschaften als Reallabore initiiert, koordiniert und beforscht.
Erfahren, Lernen und Gestalten vor Ort – in der Region für die Region!
Aktuelle Meldungen
Erstes Netzwerktreffen norddeutscher Bildungsprojekte zur Fischwirtschaft und zum Meeresschutz in Hamburg
Anfang Oktober kamen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg Vertreter:innen von vier norddeutschen Bildungsprojekten zusammen, die sich mit dem Thema Fischerei und Meeresschutz in schulischen und außerschulischen Kontexten beschäftigen. Ziel des Treffens war es, sich über Inhalte, Methoden und Materialien auszutauschen und Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit zu entwickeln. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen haben Dr.in Gabriele Diersen und Annemarie Castillo Mispireta teilgenommen.
Erstes Netzwerktreffen norddeutscher Bildungsprojekte zur Fischwirtschaft und zum Meeresschutz in Hamburg
Anfang Oktober kamen im Internationalen Maritimen Museum Hamburg Vertreter:innen von vier norddeutschen Bildungsprojekten zusammen, die sich mit dem Thema Fischerei und Meeresschutz in schulischen und außerschulischen Kontexten beschäftigen. Ziel des Treffens war es, sich über Inhalte, Methoden und Materialien auszutauschen und Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit zu entwickeln.
Im Mittelpunkte des Treffens standen der intensive fachliche Austausch und die zukünftige Zusammenarbeit und Bündelung der Aktivitäten. Diskutiert wurden pädagogische Ansätze, die didaktisch-methodische Entwicklung von Lehr-Lern-Materialien sowie die Zusammenarbeit mit Schulen und Bildungseinrichtungen.
Alle Teilnehmenden bewerteten das Treffen als wegweisend, da erstmals Expertise zusammenfließt und die Aktivitäten sinnvoll gebündelt werden können. Das gemeinsame Ziel: Die in Schulen noch wenig behandelten Themen Fischwirtschaft und Meeresschutz sollen in Zukunft sowohl im Unterricht als auch im Rahmen informeller Bildung präsenter werden und mit praxisnahen Bildungsangeboten unterstützt werden.
An dem Treffen nahmen die Projektteams der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Projekt "Fisch macht Schule - Fischerei und Aquakultur in der Schulbildung"), das Gemeinschaftsprojekt "Back to School" der DAM Forschungsmission sustainMare, die Kieler Forschungswerkstatt, die Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein ("Das Blaue Klassenzimmer") sowie unser Team vom Projekt "Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft" teil.
Das Foto zeigt v.l.n.r.: Stefanie Raddatz (Kieler Forschungswerkstatt), Jonas Müller (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Dr.in Gabriele Diersen (Universität Vechta), Annemarie Castillo Mispireta (Universität Vechta), Kai de Graaf (Center for Ocean & Society Kiel), Michèle Gürth (Selbst. Dozentin für Umweltbildung), Dr. Tobias Lasner (Johann Heinrich von Thünen-Institut Bremerhaven), Wiebke Homes (Zentrum für Marine Tropenforschung Bremen)
„Expedition Berufswelt“ im 19. Jahr - Treffen der Organisator:innen und Förder:innen
Seit 19 Jahren gibt es das Netzwerk „Expedition Berufswelt“ vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen. Eine sinnvolle Einrichtung, waren sich beim diesjährigen Treffen in der Universität Vechta erneut alle Akteur:innen und Förder:innen einig. Bietet sie doch Schülerinnen und Schülern der Ludgerus-Schule und der Geschwister Scholl-Oberschule Einblicke in die Arbeitswelt und motiviert sie zu betrieblichen Ausbildungen.
„Expedition Berufswelt“ im 19. Jahr - Treffen der Organisator:innen und Förder:innen
Viele Firmen, Einrichtungen und Behörden aus Vechta und Umgebung öffnen für potenzielle Nachwuchskräfte ihre Türen, erzählte Sabine Westermann, die das Projekt seit dem ersten Jahr koordiniert, den Kontakt zu den Firmen hält und immer wieder neue Förderer sucht. 26 Betriebserkundungen hatte es im Schuljahr 2024/25 mit Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 9 an den Oberschulen der Stadt Vechta gegeben. Alle sollen an mindestens zwei Erkundungen teilnehmen können. Zusammen mit Jan-Bernd Baumann und Monika Schürmann bereitet Sabine Westermann die Jugendlichen auf die Besuche vor. Dabei besprechen sie mit ihnen Berufsfelder, Strukturen und Informationen über das Unternehmen. Auch Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Stärken und richtiges Verhalten bei der Bewerbung kommen zur Sprache.
Die Idee zu diesem Projekt stammt vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta. Die Geschäftsführerin, Dr.in Gabriele Diersen, koordiniert diese Bildungsarbeit noch heute. Die Durchführung des Projektes liegt in den Händen von Sabine Westermann, die die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen in der Maßnahme und die Umsetzung im Unterricht realisiert. Verwaltet wird sie durch Dr. Ludger Heuer von der bischöflichen Förderstiftung „Zukunft durch Bildung“. Finanziell unterstützt wurde „Expedition Berufswelt“ im zurückliegenden Schuljahr von den Firmen Hawita Gruppe GmbH, Lamping Systemtechnik GmbH, Michalowski GmbH, Stanitech Blechbearbeitung GmbH & Co KG, Zurhake Garten & Gestaltung GmbH & Co. KG, der Mittelstandsvereinigung Vechta, dem St. Marienhospital Vechta, der Volksbank und der AOK, bauXpert GmbH, Autohaus Starke, Freunde des Inner Wheel Club Vechta e.V., WEDA Dammann & Westerkamp GmbH, der St. Hedwig-Stiftung und der Nemann GmbH.
Weitere Informationen zu "Expedition Berufswelt" sind hier nachzulesen.
Neues Bildungsangebot für Grundschulen zur Küstenfischerei in Wremen - Lernen mit allen Sinnen auf dem Krabbenkutter
Im Rahmen des Bildungsprojekts „Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft - erlebnisorientiert und engagiert“ vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen wurde in Wremen ein neuer außerschulischer Lernort zur Küstenfischerei entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Wremer Heimatkreis ´85 e.V., der das Museum für Wattenfischerei betreibt, sowie der Kutterevent & Fischerei GmbH (Inhaber des Fischkutters Claudia) ist ein praxisnahes Bildungsangebot entstanden, das Schülerinnen und Schülern spannende Einblicke in die traditionelle Krabbenfischerei der Nordseeküste ermöglicht. Am 17. und 18.09.2025 fanden die ersten Erprobungen mit dem vierten Jahrgang der Tjede-Peckes Grundschule Wremen statt.
Neues Bildungsangebot für Grundschulen zur Küstenfischerei in Wremen – Lernen mit allen Sinnen auf dem Krabbenkutter
Trotz eines angekündigten Herbststurms konnten die geplanten Kutterfahrten durchgeführt werden – sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler. Für viele von ihnen war es die erste Ausfahrt auf einem Krabbenkutter, obwohl sie in der Region aufgewachsen sind. Schon im Vorfeld der Erkundung wurden sie von der Projektverantwortlichen, Annemarie Castillo, durch eine schulische Vorbereitungseinheit auf die praktischen Inhalte eingestimmt. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler unter anderem den Aufbau und die Funktionsweise eines Krabbennetzes kennen, sodass es an Bord direkt viele AHA-Erlebnisse gab.
Im Zentrum des Programms stand eine Kutterfahrt mit dem Krabbenkutter „Claudia“, bei der Nordseegarnelen gefangen und direkt an Bord gekocht und gemeinsam gepult wurden. Mit sichtbarem Stolz und großem Spaß kam es regelrecht zu kleinen Pulwettbewerben auf der „Claudia“. Während der Fahrt lernten die Schülerinnen und Schüler außerdem die wichtigsten Seezeichen kennen und stellten der Crew um Kapitän Olaf Schmidt viele Fragen, um mehr über die Arbeit und die Arbeitsabläufe auf einem Krabbenkutter zu erfahren.
Zurück im Hafen wartete eine verdiente Stärkung in Form von frischen Fischbrötchen, bevor es zur Stationsarbeit ins Museum für Wattenfischerei ging. Dort wurde das Erlebte reflektiert und an verschiedenen Stationen weiter vertieft.
Das neue Bildungsangebot richtet sich vor allem an Grundschulklassen und verfolgt das Ziel, die regionale Fischwirtschaft, das maritime Erbe und nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten maritimer Ressourcen handlungs- und erlebnisorientiert zu vermitteln. Lehrkräfte erhalten damit die Möglichkeit, außerschulisches Lernen praxisnah und fachübergreifend zu gestalten – direkt am authentischen Lernort. In Planung ist weiterhin ein Angebot für die Sekundarstufe I.
Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Weitere Einblicke in die Projektarbeit und Impressionen der Erprobungen gibt es unter www.lernorte-fischerei.de
EUGEO 2025 in Wien: „Geographies of a Changing Europe“ – Regionales Lernen ermöglicht jungen Menschen Partizipation und eröffnet neue Perspektiven
An der österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) fand vom 08. bis 11. September 2025 die 10. EUGEO-Konferenz statt. Sie wird im zweijährigen Rhythmus vom Verbund der geographischen Gesellschaften Europas (Association of Geographical Societies in Europe) ausgerichtet. Die Konferenz verfolgte das Ziel, Lösungen und Perspektiven für räumliche, gesellschaftliche und ökologische Transformationsherausforderungen in Europa zu teilen und zur Diskussion zu stellen. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta war mit einem Vortrag zur Gestaltung transformativer Bildungslandschaften von Dr.in Hannah Lathan und Lena Neumann vertreten.
EUGEO 2025 in Wien: „Geographies of a Changing Europe“ – Regionales Lernen ermöglicht jungen Menschen Partizipation und eröffnet neue Perspektiven
An der österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) fand vom 08. bis 11. September 2025 die 10. EUGEO-Konferenz statt. Sie wird im zweijährigen Rhythmus vom Verbund der geographischen Gesellschaften Europas (Association of Geographical Societies in Europe) ausgerichtet. Die Konferenz verfolgt das Ziel, Lösungen und Perspektiven für räumliche, gesellschaftliche und ökologische Transformationsherausforderungen in Europa zu teilen und zur Diskussion zu stellen. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta war mit einem Vortrag zur Gestaltung transformativer Bildungslandschaften von Dr.in Hannah Lathan und Lena Neumann vertreten.
Die Präsentation war in der Session Transformative Education put into Practise, geleitet von Prof. Dr. Christiane Hintermann und Johanna Ruhm (beide Universität Wien), verortetund trug den Titel: „Transformative Educational Networks – from theoretical and empirical foundations to practical implementation”. Die beiden Referentinnen stellten darin das aktualiesierte Regionale Lernen3 (Regional Learning tot he power of three) vor, das insbesondere die Einbettung des Konzeptes in die aktuelle Debatte einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) fokussiert. Sie zeigten die zentrale Rolle der Region bei der Gestaltung kritisch-emanzipatorischer und transformativer Bildungsangebote für Lernende auf und wiesen wichtige Gestaltungsprinzipien von Bildungslandschaften aus. Diese sind neben der Arbeit in Netzwerken die ganzheitliche Entwicklung und Implementierung der Lehr-Lern-Arrangements, z.B. im Sinne des Whole-Institution-Approaches, die kritische Reflexion von Partizipationsaktvitäten sowie die Zusammenarbeit mit „Pionieren des Wandels“, aus der die Lernenden motiviert und selbstbewusst hervorgehen (können). In der anschließenden Diskussion wurden Fragen, z.B. zum Umgang mit strukturellen Barrieren oder unterschiedlichen Nachhaltigkeitsnarrativen, aufgeworfen, die es in der weiteren Arbeit am Kompetenzzentrum für Regionales Lernen zu adressieren gilt. Ferner wurde das umfangreiche Veranstaltungsangebot der Konferenz (Keynotes, Forschungsvorträge, City Walks) für intensives Netzwerken im internationalen Kontext genutzt.
Die Teilnahme an der Konferenz wurde durch das Europäische Förderprogramm Erasmus+ (KA1) und die Fakultät II für Natur- und Sozialwissenschaften der Universität Vechta gefördert. Wir bedanken uns für diese Unterstützung!
„Zukunft lernen, Wandel gestalten: Innovative Formate für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschule“, Tagung vom 01.-03.09.25 an der Universität Vechta
Wie gelingt es Hochschulen, unter dem Leitbild der BNE bei Studierenden transformative Kompetenzen zu fördern und sie zu befähigen, aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen? Dieser Frage widmete sich die Abschlusstagung des Projekts „Senatra“ (Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen (senatra-projekt.de)). Im Fokus standen insbesondere didaktische Konzepte wie Service Learning, das akademisches Lernen mit konkretem gesellschaftlichem Tun verbindet, und weitere Ansätze, die Nachhaltigkeit ins Herz hochschulischer Bildung tragen und somit Nachhaltigkeitskompetenzen praxisnah fördern.
Wie digitale Schulbücher und neue Lehrkonzepte Schule verändern: Tagung der Gesellschaft für Fachdidaktik in Saarbrücken
„Perspektiven der Fachdidaktiken – Schnittstellen, Übergänge, Vernetzungen“ unter diesem Fokus stand die diesjährige Jahrestagung der Fachdidaktiker:innen an der Universität Saarbrücken im Saarland, die vom 01.-03. September stattfand. Die Veranstaltung betrachtete fachdidaktische Vernetzungen zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Inklusion, Integrationsfächern und Nachhaltigkeit. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan angereist.
Bereits am ersten Tag gaben beide in Form eines Vortrags einen Einblick in das von der Europäischen Union geförderte Projekt DEM (Digital Education Material), in dem interdisziplinär digitale inklusive Schulbücher prototypisch entwickelt und übergreifende Guidelines für die Konzeption formuliert werden. Im Beitrag konnten sie aufzeigen, dass digitale Schulbücher durch Individualisierungsfunktionen wie Leichte Sprache, interaktive Formate und Feedbackmöglichkeiten enorme Potenziale für eine inklusive Bildung besitzen. Um ihre Wirksamkeit voll entfalten zu können, müssen sie daher von Grund auf digital konzipiert und im interdisziplinären Dialog entwickelt werden. Im anschließenden Austausch fand eine anregende Diskussion mit dem Plenum statt.
Am zweiten Tag moderierte Prof. Dr. Leif Mönter eine Paneldiskussion gemeinsam mit Prof. Dr. Matthias Busch von der Universität Trier zum Thema „Professionalisierung für das Unterrichten in gesellschaftswissenschaftlichen Integrationsfächern“. Dabei fokussierten die Referent:innen auf unterschiedliche Bereiche der Lehramtsausbildung: auf das universitäre Studium (Melanie Richter-Oertel, Universität Flensburg), auf den Vorbereitungsdienst (Dr. Marcel Grieger, Universität Göttingen), auf die Phase der Weiterbildung und Selbstprofessionalisierung (Prof. Dr. Matthias Busch & Michell W. Dittgen, Universität Trier) sowie die Unterrichtspraxis (Eva-Maria Glaser, Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz). Die verschiedenen Beiträge wie auch die Debatte mit den Teilnehmenden deckten Forschungsdesiderate auf und zeigten weiteren Forschungsbedarf in dem Feld der Verbundfächer. Als besonders kritisch wurde die fehlende Grundlage einer Didaktik der Gesellschaftswissenschaften betrachtet, was in der Lehramtsausbildung und der Unterrichtspraxis häufig zu Irritationen und Unsicherheiten führt.
Wie digitale Schulbücher und neue Lehrkonzepte Schule verändern: Tagung der Gesellschaft für Fachdidaktik in Saarbrücken
„Perspektiven der Fachdidaktiken – Schnittstellen, Übergänge, Vernetzungen“ unter diesem Fokus stand die diesjährige Jahrestagung der Fachdidaktiker:innen an der Universität Saarbrücken im Saarland, die vom 01.-03. September stattfand. Die Veranstaltung betrachtete fachdidaktische Vernetzungen zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Inklusion, Integrationsfächern und Nachhaltigkeit. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan angereist.
„Zukunft lernen, Wandel gestalten: Innovative Formate für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschule“, Tagung vom 01.-03.09.25 an der Universität Vechta
Wie gelingt es Hochschulen, unter dem Leitbild der BNE bei Studierenden transformative Kompetenzen zu fördern und sie zu befähigen, aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen? Dieser Frage widmete sich die Abschlusstagung des Projekts „Senatra“ (Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen (senatra-projekt.de)). Im Fokus standen insbesondere didaktische Konzepte wie Service Learning, das akademisches Lernen mit konkretem gesellschaftlichem Tun verbindet, und weitere Ansätze, die Nachhaltigkeit ins Herz hochschulischer Bildung tragen und somit Nachhaltigkeitskompetenzen praxisnah fördern.
Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen nahmen Kristin Dolezil, Lena Neumann und Dr.in Gabriele Diersen teil. In einem Workshop stellten sie Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungen mit dem Bildungskonzept Regionalen Lernen³ in der Hochschullehre vor und diskutierten mit den Teilnehmenden Chancen und Herausforderungen für die persönliche Nutzung.
Im Rahmen der Poster-Session stellte Kristin Dolezil das Projekt LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil Health) vor, welches im Rahmen der EU-Mission "A Soil Deal for Europe" gefördert wird. Das Projekt fördert den Aufbau von Kompetenzen rund um das Thema Boden in allen Bereichen der Gesellschaft (https://loess-project.eu/).
In zahlreichen Formaten ermöglichte die Tagung einen regen Austausch über die Rolle von Hochschulen und Universitäten für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Dabei zeigte sich, dass es sehr viele Bildungskonzepte und zielführende Beispiele gibt, in denen Lehr- und Lernprozesse in den Realraum wirken und so zu einer nachhaltigen Transformation der Gesellschaft beitragen.
Neue Erkenntnisse zu Angebot-Nutzungs-Interaktionen auf dem Lernort Bauernhof – Erfolgreiche Disputation von Lena Beyer
Am 10.07.2025 fand die Disputation von Lena Beyer an der Universität Vechta statt. Die Arbeit war im niedersächsischen Promotionsprogramm „GINT – Lernen in informellen Räumen“ angesiedelt, das von 2016 bis 2021 aktiv war. Die Arbeit wurde von Prof.in i.R. Dr.in Martina Flath betreut. Weitere Mitglieder der Promotionskommission waren Prof.in Dr.in Anne-Katrin Lindau (Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Zweitgutachterin), Prof. Dr. Michael Komorek (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprecher des Promotionsprogrammes GINT), Prof. Dr. Steffen Wittkowske und Prof. Dr. Leif Mönter.
Neue Erkenntnisse zu Angebot-Nutzungs-Interaktionen auf dem Lernort Bauernhof – Erfolgreiche Disputation von Lena Beyer
Am 10.07.2025 fand die Disputation von Lena Beyer an der Universität Vechta statt. Die Arbeit war im niedersächsischen Promotionsprogramm „GINT – Lernen in informellen Räumen“ angesiedelt, das von 2016 bis 2021 aktiv war. Die Arbeit wurde von Prof.in i.R. Dr.in Martina Flath betreut. Weitere Mitglieder der Promotionskommission waren Prof.in Dr.in Anne-Katrin Lindau (Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Zweitgutachterin), Prof. Dr. Michael Komorek (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprecher des Promotionsprogrammes GINT), Prof. Dr. Steffen Wittkowske und Prof. Dr. Leif Mönter.
In ihrer Arbeit entwickelte Lena Beyer ein theoretisches Modell, das Lernorte, Lernangebote, Nutzungsaktivitäten und Wirkungen systematisch beschreibt. Grundlage war eine empirische Design-Based Research-Studie in drei Zyklen am Milchviehbetrieb Hof Heil. Frau Beyer konnte empirisch belegen, dass Schülerinnen und Schüler durch Hoferkundungen nachhaltige kognitive, emotionale und handlungsorientierte Lernprozesse entwickeln, die im schulischen Kontext so nicht entstehen würden. Die Arbeit liefert erstmals empirisch fundierte Kriterien zur Charakterisierung von Lernorten und -angeboten im Regionalen Lernen. Besonders betont wird die zentrale Rolle von Expert:innen und pädagogischen Begleitkräften für den Lernerfolg. Frau Beyer entwickelte zudem acht Konzeptspezifikationen für das Lernen auf dem Bauernhof und formulierte praxisrelevante Empfehlungen zur Optimierung von Lernprozessen vor Ort. Die Ergebnisse tragen zu einer inhaltlichen Weiterentwicklung des Konzeptes des Regionalen Lernens bei. Neben der Bedeutung für die Geographiedidaktik bietet die Dissertation theoretische und praktische Impulse für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Die Promotionskommission bewertete die Arbeit mit magna cum laude und würdigte die Arbeit als methodisch und inhaltlich wertvollen Beitrag zur Forschung über außerschulisches Lernen.
China als Thema im (Geographie-)Unterricht – China-Schul-Akademie stellt neue Studie vor
Am 24.06. hat die China-Schul-Akademie die Ergebnisse einer systematischen Erhebung und umfassenden Analyse aktuell gültiger Lehrpläne und der Schulbücher digital vorgestellt. Untersucht wurden Lehrpläne und Schulbücher von 2013-2023 der Fächer Geschichte, Geografie, Sozialkunde und Ethik/Religion aus allen Bundesländern. Dr.in Hannah Lathan vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta war eingeladen, die Ergebnisse fachdidaktisch einzuordnen und die anschließende Diskussion mit Lehrkräften, Schulbuchautor:innen und Interessierten zu moderieren und zu kommentieren.
China als Thema im (Geographie-)Unterricht – China-Schul-Akademie stellt neue Studie vor
Am 24.06. hat die China-Schul-Akademie die Ergebnisse einer systematischen Erhebung und umfassenden Analyse aktuell gültiger Lehrpläne und der Schulbücher digital vorgestellt. Untersucht wurden Lehrpläne und Schulbücher von 2013-2023 der Fächer Geschichte, Geografie, Sozialkunde und Ethik/Religion aus allen Bundesländern. Dr.in Hannah Lathan vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta war eingeladen, die Ergebnisse fachdidaktisch einzuordnen und die anschließende Diskussion mit Lehrkräften, Schulbuchautor:innen und Interessierten zu moderieren und zu kommentieren.
In den Ergebnissen wurden zentrale Schwächen in aktuellen Schulbüchern deutlich. Besonders kritisch wurden stereotype Darstellungen, die oft vereinfachende Bilder von Regionen und Kulturen vermitteln eingeordnet. Auch geodeterministische Erklärungsansätze, die komplexe Zusammenhänge auf geographische Gegebenheiten reduzieren, wurden als problematisch eingestuft. Die starke Regionalisierung vieler Inhalte führt zudem zu einer Verengung der Perspektive auf einzelne Weltregionen. Positiv wurde die vorhandene Problemorientierung und thematische Strukturierung der Schulbücher hervorgehoben, die ein grundsätzlich modernes Lernkonzept erkennen lassen. Gleichzeitig wurde deutlich, dass wichtige Themenfelder wie das politische System, Menschenrechte, Digitalisierung, Jugendkulturen und Diasporas weitgehend ausgeblendet bleiben. Diese Blindstellen führen zu einer einseitigen Darstellung globaler Wirklichkeit. Es wurde gefordert, Lehrmaterialien stärker an aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auszurichten. Ziel müsse es sein, Schüler:innen ein umfassenderes, differenziertes Weltbild zu vermitteln. Die Diskussion unterstreicht den Bedarf nach einer tiefgreifenden Überarbeitung schulischer Inhalte im Sinne einer kritisch-reflexiven Bildung.
Link zum Mitschnitt des Videos: https://heibox.uni-heidelberg.de/d/46760a509cd64f4eaadd/files/?p=%2F20250624_Sitzung5_CSAStudie.mp4
Boden.Neu.Denken: Summer Camp aus dem Projekt LOESS zeigt Studierenden die besondere Bedeutung des Bodens im Klimaschutz auf
Vom 11. Juni bis zum 13. Juni an der Universität Vechta ein mehrtägiges Summer Camp für Studierende des Faches Geographie statt. Ziel der Veranstaltung war die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Boden(gesundheit) in einem interdisziplinären und praxisorientierten Rahmen. Die Exkursion wurde angeleitet von Caroline Schmidt und Kristin Dolezil. Beide sind Projektmitarbeiterinnen im Projekt LOESS, einem im Rahmen des EU-Programmes HORIZON geförderten internationalen Verbundprojekt.
Boden.Neu.Denken: Summer Camp aus dem Projekt LOESS zeigt Studierenden die besondere Bedeutung des Bodens im Klimaschutz auf
Vom 11. Juni bis zum 13. Juni an der Universität Vechta ein mehrtägiges Summer Camp für Studierende des Faches Geographie statt. Ziel der Veranstaltung war die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Boden(gesundheit) in einem interdisziplinären und praxisorientierten Rahmen. Die Exkursion wurde angeleitet von Caroline Schmidt und Kristin Dolezil. Beide sind Projektmitarbeiterinnen im Projekt LOESS, einem im Rahmen des EU-Programmes HORIZON geförderten internationalen Verbundprojekt.
Das Summercamp bot ein abwechslungsreiches Programm aus Fachvorträgen, Workshops und verschiedenen Arbeits- und Diskussionsformaten. Die inhaltlichen Schwerpunkte bildeten die Themen Bodenfunktionen, Bodenschutzmaßnahmen sowie regionale Besonderheiten der Böden. Ein zentrales Element des Summercamps waren zwei Exkursionen, die den Studierenden die Möglichkeit eröffneten, theoretisch erarbeitete Inhalte mit konkreten Praxisbeispielen zu verknüpfen. Die erste Exkursionführte zum Hof Grote, ein Betrieb, der sich auf Heil- und Gewürzpflanzen spezialisiert hat. Die zweite Exkursionermöglichte Einblicke in das Betriebsgelände von Jürgen Göttke-Krogmann, ein außerschulischer Lernstandort mit dem Fokus auf die Kulturlandschaft.
Im Rahmen der Exkursionen erhielten die Teilnehmenden Einblicke in die landwirtschaftliche Nutzung von Böden, Herausforderungen bei der Arbeit mit Böden sowie Schutzmöglichkeiten. Zudem konnten sie verschiedene Böden erfahren, Bodenproben ziehen und Ideen für die eigene Unterrichtspraxis mit Schüler:innen sammeln. Ein besonderes Highlight waren auch die Impulse der externen Referentin Sonja Medwedski, Bodenkundlerin und Autorin des Buches „Die Stimme des Bodens“. Sie lud die Teilnehmenden ein, den Boden aus einer etwas anderen, schöpferischen Perspektive zu sehen.
Expedition Berufswelt führt Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt von morgen
Am 04. Juni fand in der Ludgerusschule die Abschlussveranstaltung der Maßnahme „Expedition Berufswelt“ statt. Sie wurde 2008 von Dr.in Gabriele Diersen initiiert und wird seitdem vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta jedes Schuljahr an den Oberschulen der Stadt Vechta durchgeführt.
Expedition Berufswelt führt Schülerinnen und Schüler in die Arbeitswelt von morgen
Am 04. Juni fand in der Ludgerusschule die Abschlussveranstaltung der Maßnahme „Expedition Berufswelt“ statt. Sie wurde 2008 von Dr.in Gabriele Diersen initiiert und wird seitdem vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta jedes Schuljahr an den Oberschulen der Stadt Vechta durchgeführt.
Ob mit maßgeschneiderten Interviews, Rollenspielen oder Gastauftritten aus den besuchten Unternehmen – die Jugendlichen verstanden es auf der Abschlussveranstaltung der diesjährigen „Expedition Berufswelt“ ihr Publikum zu begeistern.
Vier Gruppen aus den Profilen Wirtschaft und Technik der Ludgerus-Schule Vechta hatten zuvor in einem 40-stündigen Programm die Arbeitswelt vor Ort kennenlernen dürfen. In kleinen Gruppen erkundeten sie jeweils 4 bis 5 Unternehmen im Raum Vechta.
Durch ein sehr abwechslungsreiches und engagiertes Programm zeigten die Schülerinnen und Schüler dem Publikum interessante Einblicke in die regionale Arbeitswelt und ihrer praxisnahen Berufsorientierung. Den zuhörenden Lehrpersonen, Unternehmensvertreter:innen sowie den zahlreich anwesenden Eltern wurde deutlich vor Augen geführt, dass viele Erlebnisse und Erfahrungen zu guten Einblicken in die besuchten Unternehmen und das betriebliche Arbeitsfeld geführt haben.
Unter reichlichem Applaus konnten die Jugendlichen ihre Zertifikate für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahme erhalten (s. Bild). Die Jugendlichen selbst bedankten sich für das Engagement aller beteiligten Unternehmen und Durchführenden.
Die Maßnahme „Expedition Berufswelt“ wird seit 2008 vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta jedes Schuljahr an den Oberschulen der Stadt Vechta durchgeführt. Finanziell gefördert wird es von verschiedenen Unternehmen der Region und der Bischöfliche Förderstiftung „Zukunft durch Bildung“, Ansprechpartner Dr. Ludger Heuer. Weitere Informationen finden sich hier (https://zukunft-bildung.org/expedition-berufswelt/alles-auf-einen-blick ).
Internationale Zusammenarbeit für inklusive digitale Schulbücher – Projekttreffen an der TU Graz
Interdisziplinärer Austausch erbringt sehr gute Fortschritte
An der Technischen Universität Graz fand das vorletzte Treffen des internationalen ErasmusPlus-Projektes DEM (Digital Education Material) vom 26.-28. Mai statt. Im Mittelpunkt der fruchtbaren Debatte stand der intensive Austausch zu den entwickelten Prototypen für digitale inklusive Schulbücher. Basis hierfür sind gemeinsam entwickelte Guidelines. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta arbeiten Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter in dem Projekt und nahmen an dem Austausch teil.
Internationale Zusammenarbeit für inklusive digitale Schulbücher – Projekttreffen an der TU Graz
Interdisziplinärer Austausch erbringt sehr gute Fortschritte
An der Technischen Universität Graz fand das vorletzte Treffen des internationalen ErasmusPlus-Projektes DEM (Digital Education Material) vom 26.-28. Mai statt. Im Mittelpunkt der fruchtbaren Debatte stand der intensive Austausch zu den entwickelten Prototypen für digitale inklusive Schulbücher. Basis hierfür sind gemeinsam entwickelte Guidelines. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta arbeiten Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter in dem Projekt und nahmen an dem Austausch teil.
Nach dem Eintreffen der Partner:innen und der Begrüßung durch die Projektleitung des Centre pour le développement des competences relatives á la vue (CDV) Luxemburg, Mike Wetzel und Tom Erdel, und die Hausherr:innen der TU Graz, Sarah Edelsbrunner, Dr.in Sandra Schön und Bernhard Kargl, begann das Meeting zunächst mit organisatorischen Fragestellungen bevor die Diskussion über die Prototypen folgte. Auf Basis theoretischer Überlegungen aus den Fachdidaktiken wurde die technische Umsetzung durch die Partner:innen gezeigt und in Kleingruppen ausführlich bezüglich der Optimierungsbedarfe diskutiert. Ein weiteres wichtiges Ziel des Treffens waren die Absprachen bezüglich der Dissemination der Projektergebnisse unter besonderer Berücksichtigung von Konferenzbeiträgen, Publikationen und dem Austausch mit Bildungsmedienverlagen.
In den Diskussionen zeigte sich, dass nur durch einen interdisziplinären Austausch von Sonderpädagogik, technischer Umsetzung und (Fach)Didaktik, die notwendige Transformation der bestehenden E-Books ermöglicht werden kann.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://dem-project.eu
„Runder Tisch der Geographiedidaktik Niedersachsen“ auf großer Fahrt
Am Freitag, den 09. Mai 2025 bot das dritte Treffen des Runden Tisches der Geographiedidaktik Niedersachsen besondere Erlebnisse und Perspektiven. Die Professor:innen und deren Arbeitsgruppen der Geographiedidaktik in und der Lehramtsausbildung an den Universitäten Hildesheim, Hannover, Osnabrück und Vechta führten das diesjährige Arbeitstreffen an der Nordseeküste in Neuharlingersiel durch. Organisiert wurde die Veranstaltung in diesem Jahr vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta.
„Runder Tisch der Geographiedidaktik Niedersachsen“ auf großer Fahrt
Am Freitag, den 09. Mai 2025 bot das dritte Treffen des Runden Tisches der Geographiedidaktik Niedersachsen besondere Erlebnisse und Perspektiven. Die Professor:innen und deren Arbeitsgruppen der Geographiedidaktik in und der Lehramtsausbildung an den Universitäten Hildesheim, Hannover, Osnabrück und Vechta führten das diesjährige Arbeitstreffen an der Nordseeküste in Neuharlingersiel durch. Organisiert wurde die Veranstaltung in diesem Jahr vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta.
Im Mittelpunkt des Austauschs stand das Projekt „Lernen und Arbeiten in der Fischereiwirtschaft – erlebnisorientiert und engagiert“, das vom europäischen Meeres-, Aquakultur- und Fischereifonds sowie dem niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefördert wird. Passenddazu wurde der Hafen in Neuharlingersiel als Treffpunkt ausgewählt, der als regionaler Lernstandort im Projektgebiet entwickelt wurde. Höhepunkt des Treffens war die Kutterfahrt auf dem ehemaligen Fischkutter „Gorch Fock“ von Anna-Lena und Willi Jacobs. Dabei wurden Einblicke in die lokale Fischereiwirtschaft vermittelt, begleitet von einem Schaufischen sowie Beobachtungen der Seehunde auf vorgelagerten Sandbänken. An Bord wurden die entwickelten Bildungskonzepte und Materialien für das handlungsorientierte Regionale Lernen vorgestellt und diskutiert. Auch die Projektziele für die weitere Laufzeit von rund 29 Monaten wurden präsentiert.
Im Anschluss kamen die Teilnehmenden zu einer abschließenden Diskussions- und Reflexionsrunde in der Kurverwaltung Neuharlingersiel zusammen. Thematisiert wurden hierbei unter anderem aktuelle Entwicklungen der Lehrplangestaltung im Fach Erdkunde, strukturelle Herausforderungen in der Lehramtsausbildung sowie Perspektiven geographiedidaktischer Forschung in Niedersachsen. Das Treffen bot einen konstruktiven Rahmen für kollegialen Austausch, die Vernetzung der Standorte sowie die Weiterentwicklung gemeinsamer geographiedidaktischer Perspektiven.
Internationale Tagung „Re-searching to transgress“ an der Universität Graz
Wie gelingt die partizipative Gestaltung der großen Transformation?
„Re-searching to transgress“ – „Forschen, um Grenzen zu überschreiten“ zu diesem Tagungsmotto hatte die Karl-Franzens-Universität vom 10. - 11. April in das österreichische Graz geladen. Zahlreiche interdisziplinär arbeitende Wissenschaftler:innen unterschiedlicher europäischer Forschungseinrichtungen diskutierten ihre theoretischen Konzepte, Projekte und Ergebnisse zur Bewältigung der großen sozial-ökologischen Transformation. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. dabei, die das DBU-geförderte Projekt PH:regBi (Planetary Health in der regionalen Bildung) vorstellten.
Internationale Tagung „Re-searching to transgress“ an der Universität Graz
Wie gelingt die partizipative Gestaltung der großen Transformation?
„Re-searching to transgress“ – „Forschen, um Grenzen zu überschreiten“ zu diesem Tagungsmotto hatte die Karl-Franzens-Universität vom 10. - 11. April in das österreichische Graz geladen. Zahlreiche interdisziplinär arbeitende Wissenschaftler:innen unterschiedlicher europäischer Forschungseinrichtungen diskutierten ihre theoretischen Konzepte, Projekte und Ergebnisse zur Bewältigung der großen sozial-ökologischen Transformation. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. dabei, die gemeinsam mit der Kollegin Svenja Sgodda, M.A. von der Justus-von-Liebig Universität Gießen, im Vortrag „Planetary Health – An integrative Approach with transformative potential for education, research, and practise“ das DBU-geförderte Projekt PH:regBi (Planetary Health in der regionalen Bildung) vorstellten. Im Beitrag standen die Entwicklung der Bildungsmodule auch deren empirische Beforschung sowie die Arbeit im Netzwerk mit medizinbezogenen Expert:innen im Mittelpunkt.
Der erste Tag begann mit den Eröffnungsworten der Gastgeber:innen Prof. Dr. Fabian Pettig, Professor für Didaktik der Geographie und Wirtschaftskunde, sowie Prof.in Dr.in Anke Strüver, Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeographie. Bereits darin wurde klar, welche bedeutende Rolle interdisziplinäre Forschung bei der Bewältigung von Transformationsherausforderungen besitzt. Im Fortgang wurden Vorträge zu unterschiedlichen Forschungsprojekten mit Fokus auf Regional- und Stadtplanung, Hochschuldidaktik oder partizipativen Forschungsmethoden gehalten. Das Highlight des Tages war die Keynote von Carlie D. Trott, PhD, Transformationsforscherin der Universität Cincinnati, die leidenschaftlich für die gemeinsame, partizipative Gestaltung der großen Transformation plädierte. Der Tag endete mit einem Konferenzdinner, bei dem intensiver Austausch stattfand.
Am zweiten Tag setzte sich die Vorstellung aktueller Arbeiten fort, wobei didaktische und pädagogische Ansätze im Vordergrund standen. In diesem Rahmen war auch der Beitrag der Vechtaer Arbeitsgruppe angesiedelt. Ferner gab es an dem Tag u.a. Workshopangebote zu Gestaltung klimaresilienter Städte sowie eine Exkursion zu einem Urban Gardening Projekt (GAIA Womens Garden).
Fünftes Konsortialtreffen des EU-Horizon-Projekts LOESS in Athen
Vom 02. bis 04. April fand in Athen das fünfte Konsortialtreffen des EU-Horizon-Projekts LOESS statt. Vertreterinnen und Vertreter der 20 beteiligten Institutionen aus 15 Ländern tauschten sich über den aktuellen Projektstand aus, reflektierten bisherige Ergebnisse und planten die nächsten Schritte. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta war in Person von Kristin Dolezil und Caroline Schmidt vertreten.
Fünftes Konsortialtreffen des EU-Horizon-Projekts LOESS in Athen
Vom 02. bis 04. April fand in Athen das fünfte Konsortialtreffen des EU-Horizon-Projekts LOESS statt. Vertreterinnen und Vertreter der 20 beteiligten Institutionen aus 15 Ländern tauschten sich über den aktuellen Projektstand aus, reflektierten bisherige Ergebnisse und planten die nächsten Schritte.
Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta nahmen Kristin Dolezil und Caroline Schmidt am Treffen teil. Sie stellten unter anderem das geplante Vorhaben zur Erstellung eines „European Atlas of Soil Education and Training“ vor und präsentierten das von ihnen entwickelte Programm für die im Projekt angesiedelten Summer Camps. Diese Camps bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich zu „Boden-Multiplikatoren“ ausbilden zu lassen. An der Universität Vechta wird diese unter dem Titel: Boden.Neu.Denken – Transformative Sommerschule für die Bodenexpert:innen von morgen vom 11.-13. Juni stattfinden. Weitere Informationen folgen.
Mehr zum Projekt, den Partnerinstitutionen und bisherigen Ergebnissen sind auf der folgenden Website verfügbar: https://loess-project.eu/
Tagung der Nachwuchswissenschaftler:innen der Geographiedidaktik in Augsburg vom 24. bis 26.03.2025
Ende März fand das alljährliche Nachwuchstreffen des Hochschulverbands für Geographiedidaktik vom 24. bis 26.03.2025 an der Universität Augsburg statt. Mit dabei waren Dr. Hannah Lathan, Madelaine Uxa und Lena Neumann, Wissenschaftlerinnen des Vechtaer Kompetenzzentrums Regionales Lernen in der Qualifizierungsphase.
Tagung der Nachwuchswissenschaftler:innen der Geographiedidaktik in Augsburg vom 24. bis 26.03.2025
Ende März fand das alljährliche Nachwuchstreffen des Hochschulverbands für Geographiedidaktik vom 24. bis 26.03.2025 an der Universität Augsburg statt. Mit dabei waren Dr. Hannah Lathan, Madelaine Uxa und Lena Neumann, Wissenschaftlerinnen des Vechtaer Kompetenzzentrums Regionales Lernen in der Qualifizierungsphase.
Dr. Hannah Lathan stellte ihre aktuellen Forschungsergebnisse aus dem Projekt „Digital Education Material“, kurz DEM, in einem Vortrag mit dem Titel „Digitale inklusive Bildungsmedien für den Geographieunterricht der Zukunft: Herausforderungen und Konzeptionsideen für Prototypen aus dem Projekt DEM“ zur Diskussion. In einer parallelen Session präsentierte Lena Neumann in ihrem Vortrag „Von Selbstwirksamkeitserfahrungen und Resignation beim Klimahandeln: Erste Ergebnisse aus Interviews im Rahmen einer Interventionsstudie zur Förderung der Handlungsfähigkeit Jugendlicher im Kontext des urbanen Klimawandels“ erste Forschungsergebnisse ihres Promotionsvorhabens. An das in diesem Rahmen ganz neue, in Japan entwickelte Pecha Kucha Format wagte sich Madelaine Uxa in ihrem Vortrag „Transformative Gespräche fördern: Veränderung des kommunikativen Verhaltens von Schüler und Schülerinnen durch soziales Lernen“: In exakt 6:40 Minuten präsentierte sie 20 Folien zu ihrem Forschungsvorhaben – mit KI generierten Bildern ohne Text, die nach 20 Sekunden automatisch wechselten. Die Leitung dieser vielseitigen Session übernahm Hannah Lathan. Des Weiteren stellten Madelaine Uxa und Lena Neumann in der Postersession die aktuellen Projekte „Planetary Health in der Regionalen Bildung (PH:regBi)“ und „Zukunftsdialog+“ des Kompetenzzentrums Regionales Lernen vor.
Neben abwechslungsreichen Vortragsformaten bereicherte auch das Rahmenprogramm die Veranstaltung. In einer Stadtführung mit dem Fokusthema „Wasser“ und bei der gemeinsamen Brauereibesichtigung nebst Verköstigung blieb viel Zeit zum Austausch und Kennenlernen der facettenreichen Stadt.
Bodenbewusstsein in der Bildung stärken – Erste Podiumsdiskussion im Projekt LOESS
Am 10. Februar 2025 fand im Rahmen des EU-geförderten Projektes LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health)die erste Podiumsdiskussion an der Universität Vechta zum Thema „Bodenbezogene Bildung im Schulkontext“ statt. Die Veranstaltung wurde von einer Gruppe Studierender im Rahmen eines Seminars unter Anleitung der Projektmitarbeiterinnen Caroline Schmidt und Kristin Dolezil geplant, organisiert und durchgeführt. Das Projekt ist in der Geographiedidaktik und im Kompetenzzentrum Regionales Lernen angesiedelt und wird auch vom Science Shop Vechta-Cloppenburg unterstützt.
Die nächste Podiumsdiskussion findet am kommenden Montag, den 17.02.2025 um 18:00 Uhr in der Aula der Universität Vechta statt. Das Thema wird die Bodenschutzbildung auf politischer und kommunaler Ebene sein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Bodenbewusstsein in der Bildung stärken – Erste Podiumsdiskussion im Projekt LOESS
Am 10. Februar 2025 fand im Rahmen des EU-geförderten Projektes LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health)die erste Podiumsdiskussion an der Universität Vechta zum Thema „Bodenbezogene Bildung im Schulkontext: Strategien für nachhaltiges, verantwortungsvolles Lernen und Kompetenzentwicklung“ statt. Die Veranstaltung wurde von einer Gruppe Studierender im Rahmen eines Seminars zu aktuellen Ansätzen und Perspektiven einer (transformativen) bodenbezogenen Bildung unter Anleitung der Projektmitarbeiterinnen Caroline Schmidt und Kristin Dolezil geplant, organisiert und durchgeführt.
Im Zentrum der Diskussion standen vielfältige Perspektiven auf die Bedeutung einer bodenbezogenen Bildung. Als Expertinnen zu Gast waren Frau Barth, Diplom-Oecotrophologin und Expertin für Bauernhofpädagogik, Frau Dr.in Geyer, Leiterin des Umweltbildungszentrums Vrees, sowie Frau Dr.in Lathan, Hochschuldozentin für Geographiedidaktik und Lehrerin, und Frau Dr.in Diersen, geschäftsführende Leiterin des Kompetenzzentrums Regionales Lernen an der Universität Vechta sowie Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Regionales Lernen – Agrarwirtschaft (AGRELA e.V.).
Im Vordergrund der Diskussion standen verschiedene praktische Ideen und Ansätze, wie dieses Thema in der Schule vermittelt werden kann. Es wurde betont, dass Bildungsansätze den Lernenden neben dem Aufbau von bodenbezogenen Kompetenzen auch die Sensibilisierung und das aktive Handeln für die Bedeutung des Bodens in ihrem eigenen Nahraum zum Ziel haben sollten. Die Expertinnen beleuchteten Ansätze, um diese Themen wirksam in schulische Bildungspläne zu integrieren und die Lebenswelt junger Menschen in den Lernprozess einzubeziehen. Zum Abschluss warfen die Diskutierenden einen Blick in die Zukunft und zeigten sich zuversichtlich, dass durch das Aufbrechen bestehender schulischer Rahmenbedingungen, eine bessere Vernetzung und gezielte Intensivierung von Bildungsangeboten positive Entwicklungen im Bereich des Bodenschutzes erzielt werden können.
Ein herzlicher Dank gilt den Expertinnen und dem Publikum für die aktive Teilnahme – und natürlich den Studierenden, deren großes Engagement die Veranstaltung erst ermöglicht hat. Die nächste Podiumsdiskussion im Rahmen des Projektes LOESS findet am kommenden Montag, den 17.02.2025 um 18:00 Uhr in der Aula der Universität Vechta statt. Das Thema wird die Bodenschutzbildung auf politischer und kommunaler Ebene sein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Presseberichte zum Kickoff des Projektes: Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft - erlebnisorientiert und engagiert
Zum Projektstart des Projektes "Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft - erlebnisorientiert und engagiert", das vom Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds der Europäischen Union gefördert wird, sind in der lokalen Presse zwei spannende Artikel erschienen. Das Projekt wird geleitetet von der Projektmitarbeiterin Annemarie Castillo Mispireta, Dr.in Gabriele Diersen und Prof. Dr. Leif Mönter.
Presseberichte zum Kickoff des Projektes: Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft - erlebnisorientiert und engagiert
Projekt LOESS wird bei internationaler Tagung vorgestellt
An der Universität Vechta hat vom 27.-29. November 2024 die Kagoshima-Vechta Konferenz zum Thema „Transformative Bildung“ stattgefunden. Im Rahmen des Programmes präsentierten viele Forschende beider Universitäten ihre Projekte und Qualifikationsarbeiten. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen war am Freitag mit Dr.in Hannah Lathan und Caroline Schmidt und einem Vortrag zum Transformativen Lernen in der Geographiedidaktik vertreten. Im Rahmen ihres Beitrages stellten sie unter anderem das aktuell laufende EU-Horizon Projekt LOESS und die daraus hervorgehenden Ansätze für transformative bodenbezogene Bildung in regionalen Kontexten vor.
Projekt LOESS wird bei internationaler Tagung vorgestellt
An der Universität Vechta hat vom 27.-29. November 2024 die Kagoshima-Vechta Konferenz zum Thema „Transformative Bildung“ stattgefunden. Ziel ist die engere Zusammenarbeit und der Aufbau einer internationalen Partnerschaft zwischen den beiden Universitätsstandorten. Bereits im November 2023 war eine Delegation der Universität Vechta nach Japan gereist, um eine Kooperation zu initiieren. Die Veranstaltung stellt insofern einen wichtigen Meilenstein für beide Institutionen dar, die der weiteren Vertiefung der Beziehungen dienen soll.
Im Rahmen des Programmes präsentierten viele Forschende beider Universitäten ihre Projekte und Qualifikationsarbeiten. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen war am Freitag, den 29. November, mit Dr.in Hannah Lathan und Caroline Schmidt und einem Vortrag zum Transformativen Lernen in der Geographiedidaktik vertreten. Im Rahmen ihres Beitrages stellten sie unter anderem das aktuell laufende EU-Horizon Projekt LOESS und die daraus hervorgehenden Ansätze für transformative bodenbezogene Bildung in regionalen Kontexten vor. Auch am Vortrag brachte sich die Arbeitsgruppe bei der Posterpräsentation ein, wobei u.a. das Erasmus+ Projekt DEM („Digital Education Material“) präsentiert und diskutiert wurde.
Neues Bildungsprojekt zur niedersächsischen Fischwirtschaft gestartet! Neue Bildungsangebote ermöglichen erlebnisorientiertes Lernen für Schülerinnen und Schüler
Um Schülerinnen und Schülern einen authentischen Einblick in den Traditionsberuf, die Berufsmöglichkeiten sowie die Erzeugung der Lebensmittel zu geben, hatte das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta das Pilotprojekt „Außerschulische Lernorte in der Fischereiwirtschaft“ umgesetzt. Das Pilotprojekt ist mittlerweile erfolgreich zu Ende gegangen – daran schließt sich nun das neue Bildungsprojekt „Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft – erlebnisorientiert und engagiert“ an. Gefördert wird das dreijährige Vorhaben aus Mitteln des „Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds“ (EMFAF) und des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums.
Neues Bildungsprojekt zur niedersächsischen Fischwirtschaft gestartet | Bildungsangebote ermöglichen erlebnisorientiertes Lernen für Schülerinnen und Schüler
Welche Meerestiere leben eigentlich in der nahegelegenen Nordsee? Wie funktioniert die deutsche Meeresfischerei? Und wie sieht die Arbeit in der Fischwirtschaft aus? Um Schülerinnen und Schülern einen authentischen Einblick in den Traditionsberuf, die Berufsmöglichkeiten sowie die Erzeugung der Lebensmittel zu geben, hatte das Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta das Pilotprojekt „Außerschulische Lernorte in der Fischereiwirtschaft“ umgesetzt. Dabei kamen Schüler*innen auch in den direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten vor Ort. Das Kompetenzzentrum hat neben den Bildungsangeboten auch grundständig das deutschlandweit einzigartige Bildungsnetzwerk zur Fischwirtschaft geknüpft. Das Pilotprojekt ist mittlerweile erfolgreich zu Ende gegangen – daran schließt sich nun das neue Bildungsprojekt „Lernen und Arbeiten in der Fischwirtschaft – erlebnisorientiert und engagiert“ an. Gefördert wird das dreijährige Vorhaben aus Mitteln des „Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds“ (EMFAF) und des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums mit einem Fördervolumen von rund 370.000 Euro.
Die Nordseefischerei steht vor großen Herausforderungen. Dazu zählen unter anderem eine alternde Fangflotte, zunehmende Einschränkung der Fanggebiete, Nachwuchssorgen sowie Nutzungskonflikte in der Nordsee. Die Nachfrage nach Fischereierzeugnissen steigt derweil weltweit und national weiter an. Zudem stellt die Fischerei für die Region ein wichtiges maritimes Erbe dar, welches zugleich eine wesentliche Basis für den Tourismus an der Küste ist. Das neue Projekt möchte Kinder und Jugendliche aktiv einbinden: Gemeinsam mit Schulen und außerschulischen Institutionen werden im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Bildungsangebote zum exemplarischen, forschenden und handlungsorientierten Lernen in der Fischwirtschaft und zum regionalen Engagement entwickelt und etabliert.
Durch das Vorhaben können Schüler*innen regionale Zusammenhänge ergründen und beginnen, in Form von eigenen Projekten, Lösungsstrategien kennen zu lernen und für aktuelle Fragestellungen zu entwickeln. Angedacht sind Aktionstage auf Hafenfesten, öffentliche Ausstellungen, eigene Forschungsprojekte oder Schüler*innenfirmen mit einer maritimen, fischereibezogenen Ausrichtung. So bekommen die Jugendlichen die Möglichkeit zur Partizipation und können zukunftsweisende Transformationsprozesse der Region mitgestalten. Das Kompetenzzentrum Regionales Lernen begleitet und unterstützt Schulen dabei, das Thema Fischwirtschaft als regional bedeutsamen Schwerpunkt ganzheitlich und langfristig in den Unterricht und die Schulkultur einzubinden und zu verankern.
Darüber hinaus wird eine digitale Bildungsplattform zur Fischwirtschaft aufgebaut. Damit soll das Angebot an entsprechenden Unterrichtsmaterialien ausgebaut werden. Die Plattform soll zahlreiche interaktive Angebote, Handreichungen für Lehrkräfte, fachliche Hintergrundinformationen und Kontakte zu außerschulischen Bildungseinrichtungen bieten. Alle Schulen im deutschsprachigen Raum sollen das nutzen können.
Über das europäische Fischereinetzwerk FAMENET werden zudem Transfermöglichkeiten der Konzepte auf weitere europäische Regionen eruiert.
Der EMFAF bietet in seinem Programm für Deutschland von 2021 bis 2027 Fördermittel für innovative Projekte, die eine nachhaltige Nutzung aquatischer und maritimer Ressourcen gewährleisten. Mit der Projektbewilligung ist das Bildungsprojekt das erste, das im zuständigen Fischwirtschaftsgebiet Niedersächsische Nordseeküste mit Mitteln aus der neuen EU-Förderperiode gefördert wird.
Die Projektleitung liegt bei Prof. Dr. Leif Mönter, Didaktik der Geographie an der Universität Vechta. Bearbeitet wird das Projekt von Annemarie Castillo Mispireta am Kompetenzzentrum Regionales Lernen / VISTRA sowie von Michèle Gürth, der Leiterin des Nationalpark-Hauses Wangerland. Dr.in Gabriele Diersen begleitet das Projekt als Geschäftsführende Leiterin des Kompetenzzentrums Regionales Lernen an der Universität Vechta.
Link zur Webseite des Projektes: https://www.lernorte-fischerei.de
Prototypen und Handlungsempfehlungen für digitale Medien entwickeln – erste Ergebnisse im DEM-Projekt ausgetauscht
Im wunderschönen herbstlichen Südtirol an der Universität Bozen traf sich vom 04. bis zum 06. November 2024 das Projektteam des ErasmusPlus-Projektes „Digital Educational Media (DEM)“. An der Außenstelle der Universität Bozen in Brixen, an dem die Arbeitsgruppe Inklusion im Bildungsbereich unter der Leitung von Prof.in Dr.in Vanessa Macchia beheimatet ist, kamen die Beteiligten zusammen. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter angereist.
Prototypen und Handlungsempfehlungen für digitale Medien entwickeln – erste Ergebnisse im DEM-Projekt ausgetauscht
Im wunderschönen herbstlichen Südtirol an der Universität Bozen traf sich vom 04. bis zum 06. November 2024 das Projektteam des ErasmusPlus-Projektes „Digital Educational Media (DEM)“. An der Außenstelle der Universität Bozen in Brixen, an dem die Arbeitsgruppe Inklusion im Bildungsbereich unter der Leitung von Prof.in Dr.in Vanessa Macchia beheimatet ist, kamen die Beteiligten zusammen. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta waren Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter angereist.
Ziel des dreitägigen Treffens, welches die halbe Laufzeit des Projektes markierte, war zunächst die Vorstellung erster Ergebnisse, die sich aus der Analyse von digitalen Schulbüchern der Fächer Geographie und Mathematik ableiten ließen. Dabei erfolgte auch ein Blick in aktuelle Fragestellungen der Didaktiken, die Impulse für die Gestaltung der zu entwickelnden Guidelines und Prototypen geben konnten. In Kleingruppen wurden anschließend zentrale Leitlinien für die Formulierung von Handlungsempfehlungen für digitale inklusive Schulbücher formuliert. Darüber hinaus zeigten die Kolleg:innen der Universitäten Graz (TU) und Hamburg sowie die Projektleitung vom Centre pour le développement des competences relatives á la vue (CDV) Luxemburg, welche technischen Umsetzungsmöglichkeiten und analogen Erweiterungen sich perspektivisch für inklusive Zielgruppen eröffnen. Dazu zählten die Ansätze des Universal Designs for Learning (UDL) oder die Arbeit mit taktilen Materialien und Medien. Der Austausch war fruchtbar, zielführend und legte bedeutende Weichen für die erfolgreiche Weiterarbeit im Projekt.
Weiter Informationen zum Projekt finden Sie hier: https://dem-project.eu
Viertes Konsortiums-Meeting im Projekt LOESS
Vom 7. bis 9. Oktober fand die vierte Konsortiums-Meeting des LOESS-Projekts statt, ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die zweite Phase des Projekts. Hauptziel des Treffens war es, die wichtigsten Maßnahmen zu skizzieren, die das erfolgreiche Erreichen der Projektziele und die langfristige Wirkung auf die Bodengesundheitserziehung gewährleisten sollen.
Viertes Konsortiums-Meeting im Projekt LOESS
Vom 7. bis 9. Oktober fand die vierte Konsortiums-Meeting des LOESS-Projekts statt, ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die zweite Phase des Projekts. Hauptziel des Treffens war es, die wichtigsten Maßnahmen zu skizzieren, die das erfolgreiche Erreichen der Projektziele und die langfristige Wirkung auf die Bodengesundheitserziehung gewährleisten sollen.
Im ersten Jahr von LOESS (Laufzeit bis Juni 2024) konzentrierten sich die Bemühungen darauf, zu bewerten, ob die bodenbezogene Bildung in Schulen, Universitäten und in der Gesellschaft insgesamt effektiv umgesetzt wird. Während des Konsortialtreffens wurde das „Deliverable 2.2“ vorgestellt, das die Ergebnisse dieser ersten Phase zusammenfasst. Dieser Bericht ist jetzt auf der Website des Projekts verfügbar, wo regelmäßig alle Aktualisierungen veröffentlicht werden.
Mit dem Eintritt der zweiten Phase des Projektes, hat sich die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von Lehrmaterialien verlagert, die die in 15 Ländern festgestellten Lücken in der bodenbezogenen Bildung schließen sollen. Während des Treffens wurden wichtige Bildungsinstrumente von LOESS erörtert, wie die Augmented Reality (AR)-App, ein MOOC und pädagogische Lehrmodule für Schüler:innen und Lehrpersonal.
Im Rahmen des Meetings wurden auch beispielhafte Fallstudien vorgestellt, die jetzt auf der Projektwebsite verfügbar sind. Darüber hinaus wurde ein Glossar mit Begriffen zur Bodengesundheit vorgestellt. Dieses Glossar wird in ein weiteres wichtiges Bildungsinstrument des Projekts, das „Crowdmapping-Tool“, einfließen, das ebenfalls auf der Tagung vorgestellt wurde.
Um die Zielgruppen - Schulen, Universitäten, die breite Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger - zu erreichen, diskutierten die Projektpartner:innen über bevorstehende Kommunikationskampagnen und spezifische Initiativen, wie die Einrichtung von vier nationalen und einem internationalen Sommercamps.
Das LOESS-Projekt setzt sich weiterhin dafür ein, das Bewusstsein für die Bedeutung der Bodengesundheit zu schärfen. Informationen zu den aktuellen Geschehnissen, Materialien und Veröffentlichungen finden Sie auf der Projekt-Website: https://loess-project.eu.
Bericht zum HGD-Symposium 2024 in Karlsruhe
Vom 30.09.2024 bis zum 02.10.2024 wurde das alle zwei Jahre stattfindende Symposium des Hochschulverbands für Geographiedidaktik an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe unter dem Leitsatz "Geographie unterrichten – Zusammenhänge verstehen – Zukunft gestalten" veranstaltet. Madelaine Uxa von der Arbeitsgruppe Geographiedidaktik und dem Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta hielt einen Vortrag zum DBU-geförderten Projekt "Planetary Health und BNE in der regionalen Bildung" (PH:regBi) zusammen mit den Kolleg:innen Dr. Christian Wittlich und Svenja Sgodda (beide Universität Bremen).
Bericht zum HGD-Symposium 2024 in Karlsruhe
Vom 30.09.2024 bis zum 02.10.2024 wurde das alle zwei Jahre stattfindende Symposium des Hochschulverbands für Geographiedidaktik an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe veranstaltet. Unter dem Leitsatz "Geographie unterrichten – Zusammenhänge verstehen – Zukunft gestalten" präsentierten Wissenschaftler:innen zahlreicher Universitäten und Hochschulen die neusten Forschungsergebnisse, Projekte und Dissertationsvorhaben. Zusätzlich konnten die über 150 Teilnehmer:innen die Themen diskutieren, Vernetzungen zwischen den Standorten schaffen und so Synergien erzeugen. Dabei waren nicht nur Wissenschaftler:innen vertreten, da durch spezielle Angebote lokale Lehrkräfte, Schüler:innen und Student:innen in die Veranstaltung gewinnbringend eingebunden werden konnten. Für das Kompetenzzentrum Regionales Lernen war Madelaine Uxa angereist. Sie übernahm die Sessionleitung einer Podiumsdiskussion zum Thema Klimabildung in der Geographie – Kontroversen und Konsensus zusammen mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe Klimabildung der Nachwuchsgruppe des HGDs. Zudem stellte sie in einem Vortrag das DBU geförderte Projekt Planetary Health und BNE in der regionalen Bildung (PH:regBi) zusammen mit den Kolleg:innen Dr. Christian Wittlich und Svenja Sgodda (beide Universität Bremen) vor. Zusätzlich gratulieren wir Frau Uxa zur erfolgreichen Wahl zum Amt der Nachwuchsprecherin des HGDs, welches sie zusammen mit Johannes Keller (PH Heidelberg) und Hanna Velling (FAU Erlangen-Nürnberg) ausführen wird.
Wir gratulieren herzlich!
„Expedition Berufswelt“ wesentliches Element der Berufsorientierung - Netzwerk bringt Jugendliche und Arbeitgeber zusammen
Seit 18 Jahren gibt es das Netzwerk „Expedition Berufswelt.“ Eine sinnvolle Einrichtung, waren sich beim diesjährigen Treffen in der Ludgerus-Schule erneut alle Akteure und Sponsoren einig. Bietet sie doch Schülerinnen und Schülern der Ludgerus-Schule und der Geschwister Scholl-Oberschule Einblicke in die Arbeitswelt und motiviert sie zu betrieblichen Ausbildungen. „Schülerinnen und Schüler empfinden die bevorstehende Berufswelt oftmals als Dschungel vieler Möglichkeiten und unbekannter Wege. Die „Expedition Berufswelt“ stellt für sie daher ein wesentliches Element der Berufsorientierung dar,“ lobte Dr.in Dorothee Belling, didaktische Leiterin der Ludgerus-Schule, das Projekt, das vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen in Person von Dr.in Gabriele Diersen initiiert und bis heute koordiniert wird.
„Expedition Berufswelt“ wesentliches Element der Berufsorientierung - Netzwerk bringt Jugendliche und Arbeitgeber zusammen
Seit 18 Jahren gibt es das Netzwerk „Expedition Berufswelt.“ Eine sinnvolle Einrichtung, waren sich beim diesjährigen Treffen in der Ludgerus-Schule erneut alle Akteure und Sponsoren einig. Bietet sie doch Schülerinnen und Schülern der Ludgerus-Schule und der Geschwister Scholl-Oberschule Einblicke in die Arbeitswelt und motiviert sie zu betrieblichen Ausbildungen. „Schülerinnen und Schüler empfinden die bevorstehende Berufswelt oftmals als Dschungel vieler Möglichkeiten und unbekannter Wege. Die „Expedition Berufswelt“ stellt für sie daher ein wesentliches Element der Berufsorientierung dar,“ lobte Dr. Dorothee Belling, didaktische Leiterin der Ludgerus-Schule, das Projekt.
Viele Firmen, Einrichtungen und Behörden aus Vechta und Umgebung öffnen für die potenziellen Nachwuchskräfte ihre Türen, erzählte Sabine Westermann, die das Projekt seit dem ersten Jahr begleitet. 23 Betriebserkundungen konnte sie mit 150 Schülerinnen und Schülern des 9. Jahrgangs im vergangenen Schuljahr durchführen. Alle sollen an mindestens zwei Erkundungen teilnehmen können, ist ihr Anspruch. Sie hält die Kontakte mit den Firmen und bereitet die Jugendlichen auf die Besuche vor. Im Vorfeld erarbeitet Westermann mit ihnen Berufsfelder, Strukturen und Informationen über das Unternehmen durch. Auch Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Stärken und richtiges Verhalten bei der Bewerbung kommen zur Sprache.
Praktische Arbeiten sind das Highlight
Bei den Betriebserkundungen sind praktische Arbeiten immer das Highlight: Schweißen oder Gabelstabler fahren in einer Werkstatt oder Blutzuckerwerte und Blutdruck messen im Krankenhaus. Sehr gut kommt es an, wenn sich der Chef oder die Chefin bei der Betriebserkundung persönlich Zeit für die Jugendlichen nimmt und ihnen damit zeigt, dass sie gern gesehene Gäste seien. Großes Lob für diese Arbeit gab es von den Firmenvertretern. Für einige Firmen stellen diese Besuche die wichtigste Kontaktmöglichkeit zu neuen Auszubildende dar. Jörn Timme von der Firma Nemann erzählte, wie man inzwischen ein ansprechendes Besuchsformat für die jungen Leute gefunden habe. Statt einer längeren theoretischen Vorstellung der Firma gehe es gleich mit Auszubildenden in die Ausstellungs-, Büro und Lagerräume. In Kleingruppen würden dann alle Prozesse und Strukturen erarbeitet und dann der ganzen Gruppe vorgestellt.
Sponsoren
Die Idee zu diesem Projekt stammte ursprünglich vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen der Universität Vechta. Seine Geschäftsführerin Dr. Gabriele Diersen koordiniert diese Bildungsarbeit noch heute. Verwaltet wird sie von der Schulstiftung St. Benedikt. Finanziell unterstützt wurde „Expedition Berufswelt“ im zurückliegenden Schuljahr von den Firmen NW-Niemann GmbH Lichttechnik, WEDA Dammann & Westerkamp GmbH, Michalowski GmbH, Nemann GmbH, Hawita Gruppe GmbH, Lamping Systemtechnik GmbH, bauXpert GmbH, Stanitech GmbH & Co. KG,Zurhake Garten & Gartengestaltung GmbH & Co. KG, der St. Hedwig-Stiftung, dem St. Marienhospital Vechta, der Volksbank, AOK und Mittelstandsvereinigung Vechta.
Lehrkräfte-Fortbildung: Bildung für Nachhaltige Entwicklung - „Lebens(t)raum Schule. Gemeinsam. Gestalten. Entdecken.“
„Lebens(t)raum Schule. Gemeinsam. Gestalten. Entdecken.“ so hat das Kompetenzzentrum für regionale Lehrkräftebildung der Universität Vechta seinen Fachtag zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung genannt und dabei am 11. September mehr als 40 Lehrkräfte und Anbieter von außerschulischen Lernstandorten am Gymnasium Twistringen begrüßen dürfen. Als Keynote-Speakerin war Dr.in Gabriele Diersen vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen geladen. Madelaine Uxa, M.A. und Caroline Schmidt, M.A. stellten in einem Barcamp die Projekte PH:regBi und LOESS vor.
Lehrkräfte-Fortbildung - Bildung für Nachhaltige Entwicklung - „Lebens(t)raum Schule. Gemeinsam. Gestalten. Entdecken.“
„Lebens(t)raum Schule. Gemeinsam. Gestalten. Entdecken.“ so hat das Kompetenzzentrum für regionale Lehrkräftebildung der Universität Vechta seinen Fachtag zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung genannt und dabei am 11. September mehr als 40 Lehrkräfte und Anbieter von außerschulischen Lernstandorten am Gymnasium Twistringen begrüßen dürfen.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand vor allem der Austausch und die Vernetzung der Teilnehmenden mit anderen Lehrkräften. Denn eines wurde deutlich: Das Thema ist schon längst in der Schule angekommen. Das machten u. a. fünf Projekte deutlich, die Vertreter*innen aus Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien vorstellten und so zeigten, wie BNE in den Schulalltag eingebunden werden kann. Wie breit Bildung für nachhaltige Entwicklung angelegt ist, verdeutlichten die Themen, die von der Kinderrechteschule über die Fahrradwerkstatt und das Stadtradeln bis hin zum FreiDay reichten. Dass Schulen unterschiedlich weit in ihrer Umsetzung des 2021 veröffentlichten BNE-Erlasses sind, wurde auch deutlich an der Vorstellung der IGS Oyten. Hier ist BNE in das gesamte Schulcurriculum eingebunden.
Dass nicht alles bis zu Ende gedacht sein muss und dass nicht auf alle Fragen eine Antwort gegeben werden kann, wurde in den anschließenden Barcamp-Sessions deutlich. Hier hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre eigenen Themen und Fragen einzubringen und mit anderen zu diskutieren. Ein Format, das gerne genutzt wird, um den Austausch unter den Teilnehmenden zu stärken und unkompliziert Partizipation herzustellen. Dass dieser Ansatz aufgegangen ist, zeigt sich auch in der Rückmeldung einer Teilnehmerin: „Die Methode des Barcamps empfand ich als sehr gewinnbringend, weil sie stressfrei und zwanglos war.“
Die Einführung in den Tag übernahm Dr.in Gabriele Diersen vom Kompetenzzentrum für regionales Lernen an der Universität Vechta. Der Impuls zeigte Möglichkeiten auf, wie durch den Besuch außerschulischer Lernorte das Lernen – sei es in der Natur, in Betrieben oder anderen Einrichtungen – gelingen kann.
Als Fazit lässt sich festhalten: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist durchaus vielfältig und bietet darüber zahlreiche Anknüpfungspunkte, um den "Lebens(t)raum Schulen" gemeinsam zu gestalten. Der Austausch über das Wie und mit wem, mithin die Vernetzung, ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Die Welt der Geographie zu Gast in Dublin
Unter dem Motto: “Celebrating a World of Difference” fand vom 24.-30. August 2024 der International Geographical Congress (IGC) an der Dublin City University statt. Diese alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung bringt Geograph:innen aus den unterschiedlichsten Ländern und Fachbereichen zusammen. Neben dem wertvollen Austausch unter den Delegierten der verschiedenen Forschungseinrichtungen wurden auch zahlreiche neue Projekte, Theorien und Konzepte vorgestellt und diskutiert. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen waren Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. angereist.
Die Welt der Geographie zu Gast in Dublin
Unter dem Motto: “Celebrating a World of Difference” fand vom 24.-30. August 2024 der International Geographical Congress (IGC) an der Dublin City University statt. Diese alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung bringt Geograph:innen aus den unterschiedlichsten Ländern und Fachbereichen zusammen. Neben dem wertvollen Austausch unter den Delegierten der verschiedenen Forschungseinrichtungen wurden auch zahlreiche neue Projekte, Theorien und Konzepte vorgestellt und diskutiert. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen waren Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. angereist. Madelaine Uxa, M.A. konnte erste Ergebnisse ihrer Dissertation vorstellen, die im DBU-geförderten Projekt PH:regBi (Planetary Health in der Regionalen Bildung) angesiedelt ist. Auch Dr.in Hannah Lathan nutzte die Gelegenheit, erste Resultate aus dem EU-Horizon geförderten internationalen Forschungsprojekt LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal Actors on Soil health) zu präsentieren. Zusätzlich leiteten die beiden Didaktikerinnen zwei Sessions mit dem Titel: „Geographical Education: New Voices in Creative Methods to Geography Education and Education for/as Sustainable Development“. Über die fachlichen Inhalte hinaus waren verschiedene Exkursionen in das Umland Dublins und weitere Teile Irlands unter fachlicher Anleitung Teil des Tagungsprogramms.
Projektvorstellung (PH:regBi) beim Fachaustausch zur Krisenresilienz im Landkreis Osnabrück
Am 14.08.2024 fand im Kreishaus Osnabrück eine Vernetzungsveranstaltung zum Thema „Krisenresilienz – Wie können wir junge Menschen auf schwierige Zeiten vorbereiten?“ statt. Eingeladen waren verschiedene Expert:innen und Stakeholder, die sich in ihren Arbeiten mit diesem Thema auseinandersetzen; darunter (Früh-)Pädagog:innen, Ärzt:innen und Psycholog:innen, Ressourcenmanager:innen und Lehr- sowie Verwaltungspersonal an Bildungsinstitutionen. Dieser Einladung folgten auch Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen, die das DBU-geförderte Projekt PH:regBi – Planetary Health in der Regionalen Bildung vorstellten.
Projektvorstellung (PH:regBi) beim Fachaustausch zur Krisenresilienz im Landkreis Osnabrück
Am 14.08.2024 fand im Kreishaus Osnabrück eine Vernetzungsveranstaltung zum Thema „Krisenresilienz – Wie können wir junge Menschen auf schwierige Zeiten vorbereiten?“ statt. Eingeladen waren verschiedene Expert:innen und Stakeholder, die sich in ihren Arbeiten mit diesem Thema auseinandersetzen; darunter (Früh-)Pädagog:innen, Ärzt:innen und Psycholog:innen, Ressourcenmanager:innen und Lehr- sowie Verwaltungspersonal an Bildungsinstitutionen. Dieser Einladung folgten auch die Geographiedidaktiker:innen der Universität Vechta Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa, M.A. vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen, die das DBU-geförderte Projekt PH:regBi – Planetary Health in der Regionalen Bildung vorstellten. Neben einer Einführung ins Thema durch einen kurzen Fachvortrag von Prof. Dr. Martin Franz von der Universität Osnabrück, der einen Einblick in seine Forschungsprojekte zur Resilienz in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen gab, wurden verschiedene Thesen zu Krisenresilienz diskutiert. Zusätzlich wurden die verschiedenen Ansätze des Umgangs mit Krisen und entscheidende Kompetenzen für deren erfolgreiche Bewältigung durch die Workshopleitung Timo Kluttig vom Landkreis Osnabrück vorgetragen. Bei all diesen Themen war das Debattieren über relevante Themen sowie das gemeinsame Entwickeln von Lösungsansätzen mit den zahlreich erschienenen interdisziplinären Gästen fruchtbar. Einen zweiten Impuls lieferte die Delegation des Kompetenzzentrums Regionales Lernen zum Projekt PH:regBi. Dr.in Hannah Lathan und Madelaine Uxa stellten nicht nur einen möglichen praktischen Zugang zum Thema vor bei dem neben der theoretischen Basis auch einige Materialien der Lehr-Lernmodule gezeigt wurden, sondern gestalteten die Diskussion aktiv mit. Ein Anschlusstreffen ist geplant.
Vortrag zum Thema "Bildung für gesunden Boden – das Projekt LOESS" im Rahmen der Veranstaltung "Transformation in Kurz&Knackig"
Am 18.06.2024 hielt Prof. Dr. Leif Mönter einen Vortrag bei der von trafo:agrar durchgeführten Veranstaltung "Transformation in Kurz & Knackig", diesmal zum Thema "Mission Gesunde Böden. Vom Nutzen europäischer Forschungs- und Innovationsprojekte". Der Beitrag von Herrn Mönter stand unter dem Titel "Bildung für gesunden Boden – das Projekt LOESS“.
Vortrag zum Thema "Bildung für gesunden Boden – das Projekt LOESS" im Rahmen der Veranstaltung "Transformation in Kurz&Knackig"
Am 18.06.2024 hielt Prof. Dr. Leif Olav Mönter einen Vortrag bei der von trafo:agrar durchgeführten Veranstaltung "Transformation in Kurz & Knackig", diesmal zum Thema "Mission Gesunde Böden. Vom Nutzen europäischer Forschungs- und Innovationsprojekte". Der Beitrag von Herrn Mönter stand unter dem Titel "Bildung für gesunden Boden – das Projekt LOESS“.
Das dreijährige Projekt „LOESS - Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil Health“ wird im Rahmen von Horizont Europa gefördert. Es bringt Vertreter*innen von zwanzig Partnerorganisationen aus 16 europäischen Ländern zusammen. LOESS Partner*innen vernetzen und engagieren sich mit Akteur*en in Communities of Practice (CoPs), um einen effektiven Wissensfluss und Diskurs zwischen Pädagog*innen und Lernenden sowie zwischen wissenschaftlichen, politischen, individuellen, lokalen und kollektiven kulturellen Wissenssystemen zu fördern. Neben einem Überblick über den aktuellen Stand des bodenbezogenen Wissens in verschiedenen Bildungsstufen wird LOESS eine Reihe von erfahrungsbasierten Lernmodul-Werkzeugen für den bereichsübergreifenden Einsatz in Schulen und Universitäten sowie für die breite Öffentlichkeit gemeinsam entwickeln und testen. Am Standort kooperieren dafür der Science Shop Vechta/Cloppenburg und das Fach Didaktik der Geographie an der Universität Vechta.
Den Link zum Videomitschnitt der Veranstaltung finden Sie hier.
Rückblick zum Interdisziplinären Kolloquium der Fachdidaktiken in der Transformation zur Nachhaltigkeit an der Universität Wien
Vom 07. bis 09. Juni 2024 trafen sich Fachdidaktiker:innen aus unterschiedlichen Fächern im Rahmen des „Interdisziplinären Kolloquiums der Fachdidaktiken in der Transformation zur Nachhaltigkeit“ an der Universität Wien. Es wurden Konzepte und konkrete Projekte diskutiert, wie transformative Bildung interdisziplinär umgesetzt werden kann. Prof. Dr. Leif Mönter vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen präsentierte dabei das von der DBU geförderte Projekt PH:regBi.
Rückblick zum Interdisziplinären Kolloquium der Fachdidaktiken in der Transformation zur Nachhaltigkeit an der Universität Wien
Vom 07. bis 09. Juni 2024 trafen sich Fachdidaktiker:innen aus unterschiedlichen Fächern im Rahmen des „Interdisziplinären Kolloquiums der Fachdidaktiken in der Transformation zur Nachhaltigkeit“ an der Universität Wien. Es wurden Konzepte und konkrete Projekte diskutiert, wie transformative Bildung interdisziplinär umgesetzt werden kann. Prof. Dr. Leif Mönter vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen präsentierte dabei das von der DBU geförderte Projekt „PH:regBi: Planetary Health in der regionalen Bildung : Entwicklung von Lehr-Lern-Modulen im Kontext Klimawandel“, bei dem insbesondere in Kooperation mit Mediziner:innen ein Konzept sowie Module zur Integration von Planetary Health in die schulische Bildung entwickelt werden. Der interdisziplinäre Austausch gerade auch mit Kolleg:innen aus Österreich erwies sich dabei als sehr gewinnbringend.
Projekte des Kompetenzzentrums Regionales Lernen beim Jahrestreffen der amerikanischen Geograph:innen (AAG) in Honolulu
Der Verband der amerikanischen Geograph:innen (American Association of Geographers – AAG) traf sich zu seinem diesjährigen Jahresmeeting vom 16. bis 20. April 2024 im hawaiianischen Honolulu. Die Konferenz ist eine der größten interdisziplinären Foren für Geograph:innen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsexpert:innen, an dem auch in diesem Jahr über 4.000 Forscher:innen teilnahmen. Auf der Konferenz vertreten mit einer Sessionleitung und zwei Vorträgen war auch das Kompetenzzentrum Regionales Lernen mit Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan.
Projekte des Kompetenzzentrums Regionales Lernen beim Jahrestreffen der amerikanischen Geograph:innen (AAG) in Honolulu
Der Verband der amerikanischen Geograph:innen (American Association of Geographers – AAG) traf sich zu seinem diesjährigen Jahresmeeting vom 16. bis 20. April 2024 im hawaiianischen Honolulu. Die Konferenz ist eine der größten interdisziplinären Foren für Geograph:innen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsexpert:innen, an dem auch in diesem Jahr über 4.000 Forscher:innen teilnahmen. Auf der Konferenz vertreten mit einer Sessionleitung und zwei Vorträgen war auch das Kompetenzzentrum Regionales Lernen mit Prof. Dr. Leif Mönter und Dr.in Hannah Lathan.
Gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Christian Wittlich von der Universität Bremen leitete Prof. Dr. Leif Mönter am Mittwoch (17.04.2024) eine Session mit dem Titel „Planetary future – transformative potential of geographic education“. Darin präsentierten beide das Kooperationsprojekt „Planetary Health in der regionalen Bildung (PH:regBi)“ mit dem Vortrag „Planetary Health (PH): An effective addition to Education for Sustainable Development (ESD) in geographic learning settings related to climate change?”. Platziert in der Session war ebenfalls Dr.in Hannah Lathan mit einem Vortrag zum Erasmusprojekt DEM: „Digital and inclusive textbooks for transformative learning – inspirations from the interdisciplinary project DEM”. Auch ein Poster zum Projekt PH:regBi wurde auf der Konferenz vorgestellt. Das umfangreiche Veranstaltungsangebot der Konferenz wurde intensiv genutzt, um gemeinsam mit den Expert:innen zu diskutieren, sich international zu vernetzen und bestehende Kontakte zu pflegen.
Die Konferenzteilnahme wurde durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die Universitätsgesellschaft Vechta (UGV) unterstützt. Wir danken den Förderinnen und Förderern herzlich!
Zweites internationales Meeting zum DEM-Projekt in Hamburg
Vom 03. bis 05. April trafen sich an der Universität Hamburg die Partner:innen im Erasmusprojekt DEM (Digital Education Material) zum zweiten internationalen Meeting. Ziel war es, die Kriterien für die Analyse bereits ausgewählter digitaler, inklusiver Schulbücher der Fächer Geographie und Mathematik festzulegen. Darüber hinaus wurden erste Eckpunkte der zu entwickelnden Guidelines für die Gestaltung digitaler, inklusiver Schulbücher thematisiert. Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen waren vor Ort.
Zweites internationales Meeting zum DEM-Projekt in Hamburg
Vom 03. bis 05. April trafen sich an der Universität Hamburg die Partner:innen im Erasmusprojekt DEM (Digital Education Material) zum zweiten internationalen Meeting. Ziel war es, die Kriterien für die Analyse bereits ausgewählter digitaler, inklusiver Schulbücher der Fächer Geographie und Mathematik festzulegen. Darüber hinaus wurden erste Eckpunkte der zu entwickelnden Guidelines für die Gestaltung digitaler, inklusiver Schulbücher thematisiert. Dr.in Hannah Lathan und Prof. Dr. Leif Mönter vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen waren vor Ort.
Am ersten Tag wurden Fragen zum Projektreporting und -monitoring geklärt und an den Kriterien für digitale, inklusive Schulbücher gearbeitet. Besonders fokussiert wurde dabei auf technische, inklusive und didaktisch-methodische Kriterien und deren inhaltliche Ausdifferenzierung auf Basis von gesichteter Fachliteratur. Auch der zweite Tag stand ganz im Lichte dieser Diskussion, die durch einen fachlichen Vortrag von Wiebke Gewinn und Heike Hacker, welche die praktische Arbeit an den Kooperationsschulen der Universität Hamburg begleiten, bereichert wurde. Im Anschluss erfolgten erste exemplarische Analysen zweier Schulbücher. Der letzte Tag des Meetings hatte zum Ziel, die Öffentlichkeitsarbeit im Projekt zu koordinieren. Dabei kamen Publikationsmöglichkeiten und Projektvorstellungen, u.a. der Universität Vechta beim Annual Meeting der American Association of Geographers am 17.04.2024 in Honolulu, zur Sprache.
Bericht zur HGD-Nachwuchstagung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 2024
An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg trafen sich vom 25. bis 27.03.2024 die Nachwuchswissenschaftler:innen der Geographiedidaktik. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen war Madelaine Uxa mit dabei, die das Forschungsprojekt "Planetary Health in der Regionalen Bildung (PH:regBi)" mit einem Vortrag und einem Poster vorstellte.
Bericht zur HGD-Nachwuchstagung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 2024
An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg trafen sich vom 25. bis 27.03.2024 die Nachwuchswissenschaftler:innen der Geographiedidaktik. Vom Kompetenzzentrum Regionales Lernen war Madelaine Uxa mit dabei. Die dreitägige Veranstaltung begann mit einer kurzen Führung durch die Pädagogische Hochschule Heidelberg, gefolgt von einer Stadtexkursion, in der nicht nur architektonische Besonderheiten, sondern vor allem die Geschichte der Universität im Mittelpunkt standen. Nach einer individuellen Erkundung der Stadt fand das erste Austauschtreffen statt. Der offizielle Teil begann am Dienstag, den 26.03., mit einer Begrüßung durch Prof. Dr. Alexander Siegmund. Darauf folgten zahlreiche Sessions, in denen die Nachwuchswissenschaftler:innen ihre Forschungs- und Dissertationsvorhaben, aktuelle Herausforderungen oder auch die Ergebnisse ihrer Arbeiten präsentierten. Dabei waren die Formate der Vorstellungen vielfältig: von 15-minütigen Vorträgen bis Posterpräsentationen war alles dabei. Am Dienstag hielt Madelaine Uxa aus der Vechtaer Arbeitsgruppe ihren Vortrag, auf den eine angeregte Diskussion sowie ein Gespräch mit dem von ihr gewählten Experten Prof. Dr. Fabian Pettig (Universität Graz) folgte. Der dritte Tag begann mit einer weiteren Session, bevor sich dann die inhaltlichen und methodischen Fachgruppen des Nachwuchses trafen.
Drittes LOESS-Konsortialtreffen in Brescia, Italien
Das dritte Konsortialtreffen des LOESS-Projekts (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal Actors on Soil Health), das von der Universität Brescia (UNIBS) ausgerichtet wurde, fand vom 11.-13. März statt und konnte bedeutende Fortschritte und fruchtbare Diskussionen verbuchen. Das Team der Universität Vechta sowie die deutsche Community of Practice (CoP) sind nun auch auf der Projekt-Website vertreten: https://loess-project.eu/vechta-team/ & https://loess-project.eu/cop-1/.
Drittes LOESS-Konsortialtreffen in Brescia, Italien
Das dritte Konsortialtreffen des LOESS-Projekts (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal Actors on Soil Health), das von der Universität Brescia (UNIBS) ausgerichtet wurde, fand vom 11.-13. März statt und konnte bedeutende Fortschritte und fruchtbare Diskussionen verbuchen.
Drei Tage lang kamen Vertreter*innen von 20 Partnern aus 16 europäischen Ländern zusammen, um die Projektziele voranzutreiben und die Zusammenarbeit bei der Überbrückung der Wissenslücke in der Bodenbildung zum Schutz dieser lebenswichtigen Ressource zu stärken. Die Teilnehmenden gaben wertvolles Feedback, bereicherten die Diskussionen und leiteten das Konsortium zu wirkungsvollen Ergebnissen.
Während des Treffens konzentrierten sich die Diskussionen nicht nur auf das Engagement des globalen Konsortiums im Rahmen der Bewältigung kritischer Herausforderungen im Bereich der Bodengesundheit, sondern betonten auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Bodenprojekten der Mission, wie z. B. dem Schwesterprojekt CURIOSOIL, das sich ebenfalls auf die Bodenbildung konzentriert. Der Aufbau eines geeigneten Netzwerks für strategische Allianzen ist für das Erreichen gemeinsamer Ziele unerlässlich.
Das Team der Universität Vechta sowie die deutsche Community of Practice (CoP) sind nun auch auf der Projekt-Website vertreten: https://loess-project.eu/vechta-team/ & https://loess-project.eu/cop-1/.