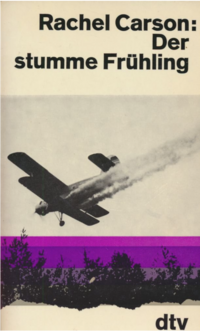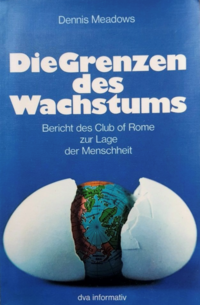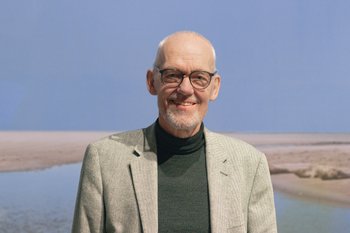Draussen
Andreas Flug
Schon als Kind liebte ich es, draussen zu sein. Beim Schreiben meiner Klimageschichte war ich überrascht und zugleich entsetzt, wie lange wir schon um die Gefährdung der Natur wissen und wie wenig wir unseren Lebensstil verändert haben.
Meine Klimageschichte beginnt schon Ende der fünfziger Jahre. Zu einer Zeit, als Worte wie Klima oder Klimawandel, Umweltveränderungen oder die Gefährdung der Natur, wenn überhaupt, nur zum Vokabular einiger weniger Wissenschaftler*innen gehörten. Ich bin auf einem norddeutschen Dorf aufgewachsen. Und Natur, das war für mich - draußen. „Geht nach draußen zum Spielen“, sagte unsere Mutter, wenn wir Kinder sie mal wieder bei ihrer Hausarbeit störten. Draußen, das waren die Bäume, die gar nicht hoch genug sein konnten, um trotz Verbot in ihnen herum zu klettern. Das waren die Hecken, aus denen wir die Vögel aufscheuchten, wenn wir uns darin versteckten. Draußen, das waren die Wiesen, auf denen wir im Frühjahr die Blumen pflückten, die wir Mutter dann zum Muttertag schenkten. Das waren die Felder mit Getreide, blauen Kornblumen und leuchtend rotem Klatschmohn - und ohne Mais! Draußen, das waren die Gärten mit süßen Erdbeeren, frischen Erbsen und leckeren Kirschen. Aber all das war nur Kulisse unserer Abenteuerspiele. Sie waren einfach da - immer. Nicht wert, genauer beachtet zu werden. Das änderte sich für mich mit Tante Hete und Onkel Karl. Sie waren nicht wirklich Tante und Onkel, sondern Nachbarn. Aber damals sagte man als Kind zu älteren Leuten, die man kannte, noch Tante oder Onkel. So war das auch bei Tante Hete und Onkel Karl. Durch sie habe ich zum ersten Mal die Natur gesehen. Die beiden machten jeden Sonntag einen langen Spaziergang. Als sie mich fragten, ob ich sie nicht begleiten wollte, war ich zwar nicht Feuer und Flamme, aber die Sonntage waren so langweilig, dass alles besser war, als zu Hause rumzusitzen. Also ging ich mit und habe gestaunt, was es „da draußen“ alles zu entdecken gab. Die Bäume und Sträucher hatten alle verschiedene, manchmal auch ganz komische Namen. Zum Beispiel die Zitterpappel, von denen manche Kätzchen trugen. Oder die Buchen, deren Früchte Eckern heißen und die man sogar essen kann. Onkel Karl erzählte, dass sie im Krieg Öl daraus gepresst haben. Oder die Kopfweiden, von denen Tante Hete ein paar Zweige abschnitt. Sie liebte die samtenen Weidenkätzchen ebenso wie die Bienen, die von ihnen Nektar für den leckeren Honig sammelten. Andere staubten, wenn man sie anstieß. Aus den Zweigen der Weiden und der Hasel- und Holundersträucher konnte Onkel Karl in wenigen Minuten eine Flöte schnitzen und eine richtige Melodie darauf spielen! „Alle Vögel sind schon da …“. Ja, die Vögel! Einer sah schöner als der andere aus. Ob Dompfaff, den manche auch Gimpel nennen, oder Rotkehlchen, ob Kiebitz oder Rebhuhn, ob Goldammer, Grünfink oder leuchtendbunter Eisvogel - Tante Hete konnte sie alle an ihrem Gesang erkennen. Den Kuckuck und die Lerche konnte ich zwar nicht sehen, aber ihre Stimmen kannte ich bald auch.
Mit Tante Hete und Onkel Karl bin ich später zwar nicht mehr unterwegs gewesen, aber, und deshalb erzähle ich so ausführlich von den beiden, sie haben mir die Augen für die Vielfalt unserer heimischen Natur geöffnet. Sie haben mein Interesse geweckt. Aber dass diese Natur einmal gefährdet sein könnte, das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Bis Dr. Unteutsch, unser Biologielehrer am Gymnasium, Ende der sechziger Jahre ein Buch mit in den Unterricht brachte: Rachel Carson - Der stumme Frühling. Die amerikanische Biologin beschreibt darin die Auswirkungen eines damals üblichen, rigorosen Pestizid-Einsatzes, vor allem von DDT, auf die Ökosysteme. Dr. Unteutsch konnte uns damals nicht wirklich für das Buch und sein Thema interessieren/begeistern. „Stummer Frühling!“ Was für eine maßlose Übertreibung und Panikmache! Die Natur war doch voll von Vögeln! Da draußen war im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Und außerdem gab es mit sechzehn Wichtigeres, als Pestizide und irgendwelche gefährdeten Vögel. In einer der letzten Biologiestunden, wir hatten alle unser Abitur in der Tasche und wollten so schnell wie möglich raus ins richtige Leben, brachte er wieder ein Buch mit: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Die Studie beschreibt, dass das individuelle, lokale Handeln aller Menschen globale Auswirkungen hat. Auswirkungen, die weit über den Zeithorizont und Handlungsraum des Einzelnen hinausgehen. Und dass die Menschheit mit den begrenzten Ressourcen des Planeten sehr sorgsam umgehen muss, wenn sie eine Zukunft haben will. „Lesen Sie es!“, sagte er, „Ihre Generation wird darüber entscheiden, ob das, was die Forscher prognostizieren, wahr wird oder nicht.“
Ein Jahr später, 1973, gab es dann den ersten Ölschock. Meine Frau und ich pflegten - wie so einige in meiner Generation - einen ökologischen Lebensstil mit eigenem Gemüsebeet, Einkaufen im Bioladen, Windeln aus Stoff, Demos vor dem AKW und Liedern von BOTS. Auf der anderen Seite wollten wir trotzdem tolle Autos fahren, verreisen und sich was leisten können, konsumieren eben…Natürlich waren wir auch hin und wieder mit unseren Kindern in der Natur. Unsere beiden Mädchen waren begeisterte „GU-Naturforscher“. Sie hatten ein Bestimmungsbuch aus dem Verlag Gräfe und Unzer, GU eben, im Bücherregal gefunden und wollten nun draußen all das wiederfinden, was im Buch an Pflanzen und Tieren abgebildet war. Rachel Carson und der Club of Rome waren in jenen Jahren weit weg. Waren sie natürlich nicht! Denn die immer eindringlicheren Warnungen der Wissenschaftler*innen waren irgendwann nicht mehr zu überhören. Worte wie „Klima oder Klimawandel, Umweltveränderungen oder die Gefährdung der Natur“ kennt heute fast jedes Kind. Und ich, wir alle sind mittendrin. Meine Frau und ich versuchen unseren Garten so naturnah, vogel- und insektenfreundlich wie nur möglich zu gestalten. Aber Dompfaff oder Goldammer habe ich nicht wieder gesehen. Ich freue mich schon über einen Stieglitz oder ein Rotkehlchen im Garten. Und ich bleibe stehen, wenn ich draußen im Feld einen Kiebitz sehe oder eine Lerche höre. Immer mehr Vogelarten stehen auf der roten Liste oder verschwinden ganz. Doch dass es am Dümmer wieder Seeadler gibt und der Storch zurückgekommen ist, dass der Kranich inzwischen in Norddeutschland wieder eine etablierte Art mit mehreren Tausend Brutpaaren ist, stimmt mich ein kleines bisschen hoffnungsvoll. Es ist wenig, aber mehr als nichts.
Ich denke noch manchmal an Dr. Unteutsch und seine mahnenden Worte. Neulich habe ich auch wieder an Tante Hete und Onkel Karl denken müssen. Meine Frau und ich waren mit Carlotta, unserer zweijährigen Enkelin, auf dem Spielplatz. Carlotta lief voraus zur Rutsche und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Dann ging sie in die Hocke. „Da!“, sagte sie und zeigte auf eine stachelige Raupe. „Oh“, sagte ich, „Das ist ja die Raupe Nimmersatt!“ Carlotta nickte: „Und dann Metterling!“ „Ja“, antwortete meine Frau, „Einmal wird aus der Raupe ein schöner, bunter Schmetterling!“ Ich freue mich schon jetzt, wenn wir mit Carlotta wieder in die Natur gehen und mit ihr entdecken, wie wunderbar und kostbar alles ist.
Andreas Flug, Dezember 2024